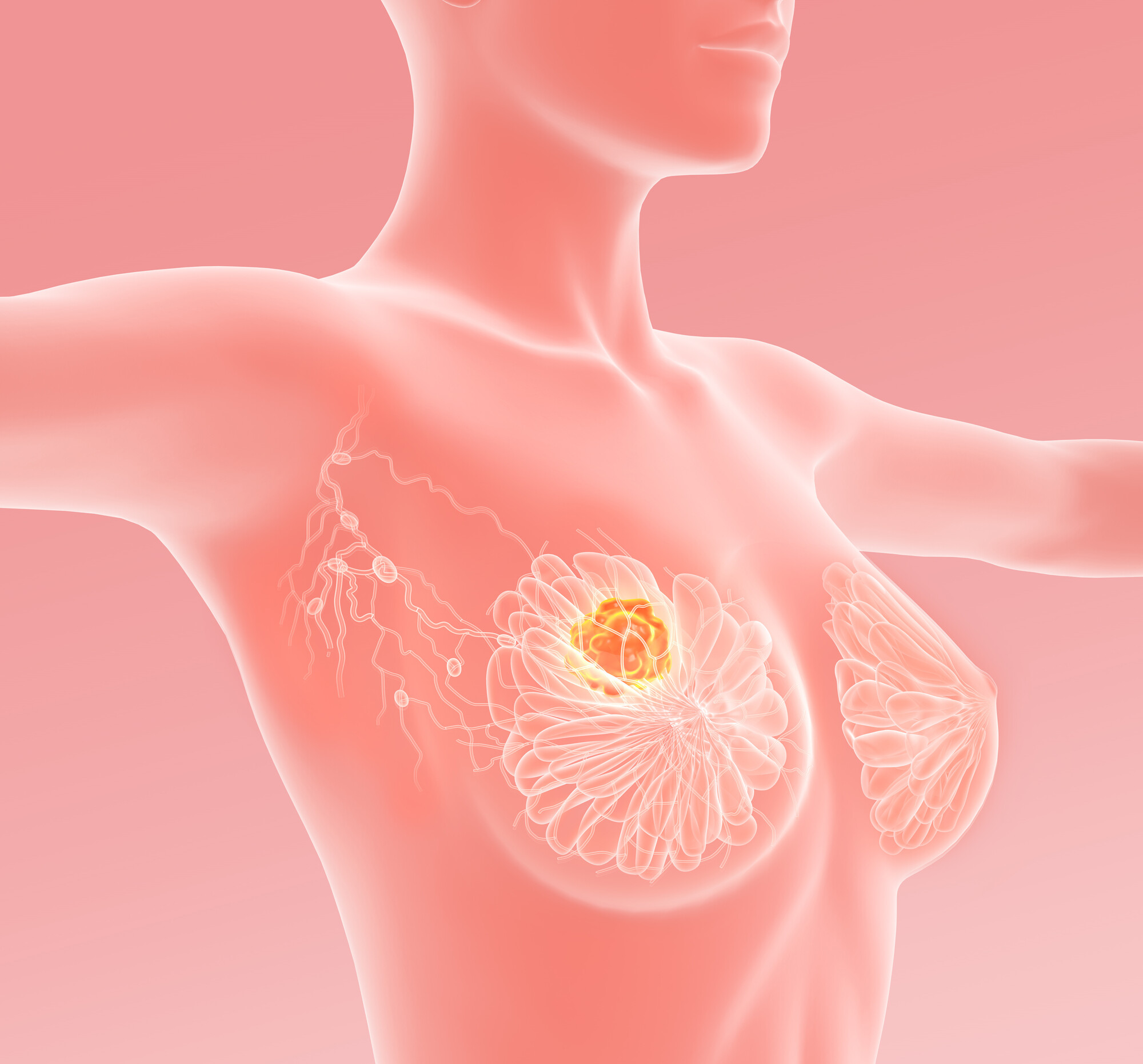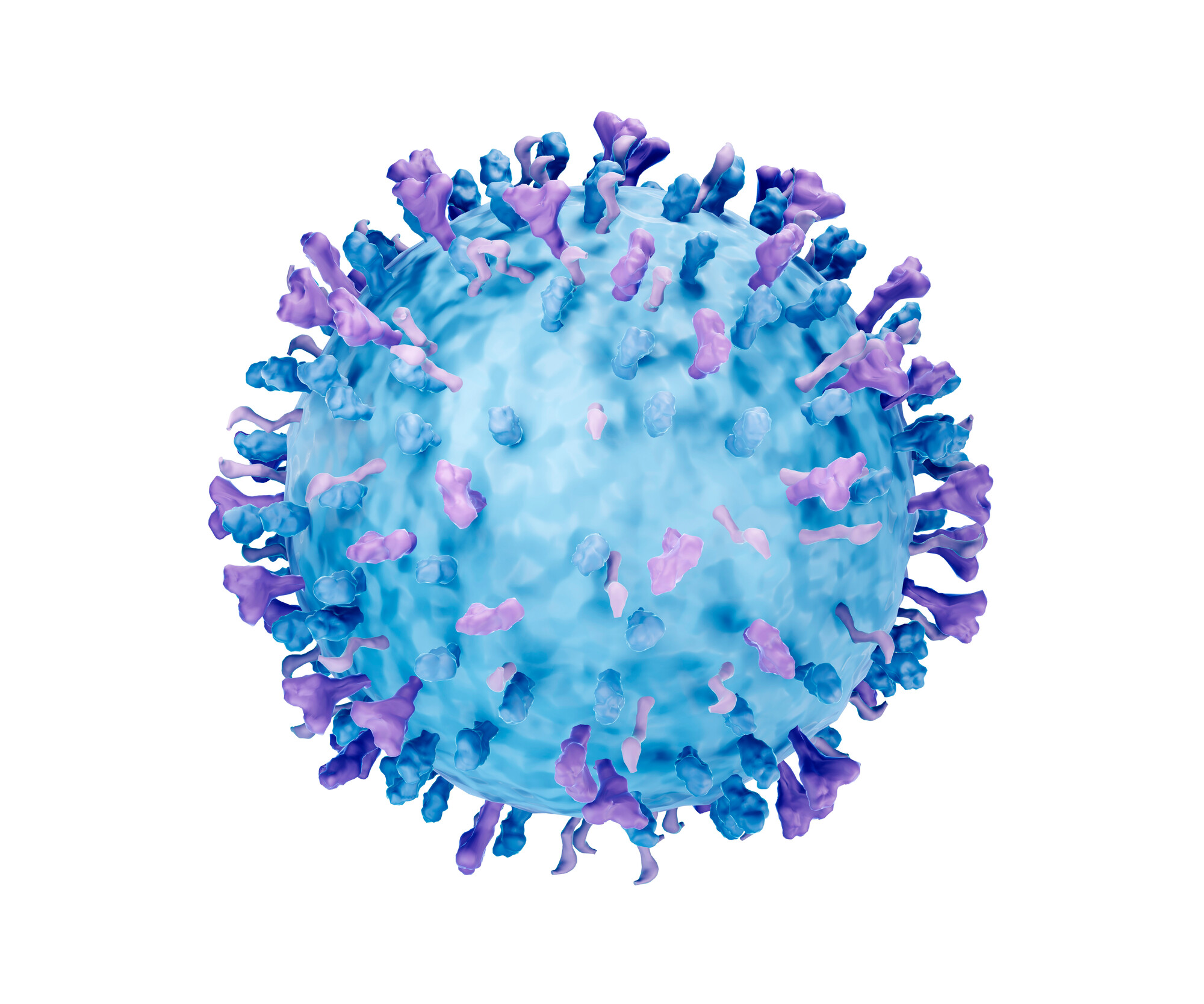Berlin. Gesetzlich Versicherte, die an einem Lipödem leiden, können zukünftig unabhängig vom Stadium der Erkrankung mit einer Liposuktion behandelt werden. Die operative Fettabsaugung wird unter bestimmten Bedingungen eine reguläre Leistung der Krankenkassen. Das hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) in seiner Sitzung am Donnerstag (17. Juli) beschlossen und konkrete Voraussetzungen formuliert (s. unten).
Bislang ist die Liposuktion nur bei einem Lipödem im Stadium III und als befristete Ausnahmeregelung eine Kassenleistung. Diese wäre Ende des Jahres ausgelaufen.
Wichtig in der Praxis: Geht das Lipödem mit einem bestimmten Ausmaß einer Adipositas einher, muss diese vorrangig behandelt werden. “Bei einem BMI-Wert von mehr als 35 kg/m² ist die Liposuktion unzulässig”, heißt es im schriftlich vorliegenden Beschluss des G-BA.
Ergänzend betonte G-BA-Vorsitzender Prof. Josef Hecken hierzu, dass keine Einschränkungen bei der konservativen Behandlung für die betroffenen Frauen geplant oder gewollt seien – unabhängig davon, ob diese eine Liposuktion anstrebten oder nicht. Im Gegenteil: Konservative Maßnahmen wie Stützstrümpfe oder Lymphdrainage bräuchten viele Patientinnen, um überhaupt die Kriterien für eine Liposuktion erfüllen zu können. Sibylle Steiner von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung informierte, dass man bereits mit dem GKV-Spitzenverband in guten Gesprächen sei, den besonderen Verordnungsbedarf für diese Heilmittel fortzusetzen.
Studie belegt Nutzen der Liposuktion
Wissenschaftliche Grundlage sind erste Ergebnisse der vom G-BA veranlassten Erprobungsstudie LIPLEG. Sie stammen aus den ersten zwölf Monaten der noch laufenden Studie von Mitte April, geht aus den tragenden Gründen für den Beschluss hervor. Ein Abschlussbericht ist demnach für Anfang 2027 geplant. G-BA-Vorsitzender Hecken unterstrich aber mehrfach mit Blick auf Gerichte und Juristen, dass er die Zwischenergebnisse Stand jetzt “als Evidenzkörper für so ausreichend (hält), um den Einschluss (der Liposuktion in den GKV-Katalog) evidenzbasiert begründen zu können”. Die Ergebnisse seien “ausreichend, belastbar und der primäre Endpunkt positiv”.
Insgesamt 410 Menschen in elf Studienzentren in Deutschland wurden in die Studie eingeschlossen. Verglichen wurde die Liposuktion mit einer alleinigen nichtoperativen Behandlung (Komplexe Physikalische Entstauungstherapie, KPE).
Im Liposuktionsarm konnten 68 Prozent der Patientinnen den primären Endpunkt Schmerzreduktion in den Beinen erreichen, während im KPE-Arm bei knapp 8 Prozent eine relevante Schmerzreduktion erzielt werden konnte (OR [95%-KI]: 26,3 [13,2; 52,6]; p < 0,001). “Auch die Analysen in den einzelnen Stadien I bis III zeigten jeweils einen deutlichen Effekt zugunsten der Liposuktion”, heißt es.
Auch bei der Bewegungseinschränkung zeigten sich deutliche Verbesserungen (relevante Verbesserung bei 70 Prozent im Lipo-Arm versus 10 Prozent im KPE-Arm; OR: 21,0 [10,8; 40,7]; p < 0,001). Ebenso konnte eine reduzierte Depressionsneigung festgestellt werden.
Über die Einblicke in den tragenden Gründen des G-BA hinaus ist die LIPLEG-Studie bislang nicht veröffentlicht. Weitere wichtige Erkenntnisse, beispielsweise zur Notwendigkeit von Wiederholungseingriffen, werden noch erwartet, so Dr. Bernhard van Treeck, unparteiisches Mitglied des G-BA und Vorsitzender des beschlussvorbereitenden Unterausschusses Methodenbewertung. Auch G-BA-Chef Hecken betonte, selbstverständlich werde der G-BA seiner Beobachtungspflicht nachkommen und prüfen, ob es am Beschluss Nachbesserungs- oder Veränderungsbedarf gibt, wenn die Endergebnisse vorliegen.
Konkrete Voraussetzungen formuliert
Folgende Voraussetzungen hat der G-BA im schriftlich vorliegenden Beschluss formuliert:
- Die Liposuktion darf erst erbracht werden, wenn die konservative Behandlung nicht hinreichend war. Es muss über einen Zeitraum von sechs Monaten eine konservative Therapie wie z. B. Kompressions- und Bewegungstherapie kontinuierlich durchgeführt worden sein.
- Die Diagnose ist durch eine Fachärztin oder einen Facharzt für Innere Medizin und Angiologie, für Physikalische und Rehabilitative Medizin oder für Haut- und Geschlechtskrankheiten oder durch eine Fachärztin oder einen Facharzt mit Zusatz-Weiterbildung Phlebologie zu stellen.
- Keine Gewichtszunahme in den letzten sechs Monaten vor der Indikationsstellung zur Liposuktion
- Bei BMI-Werten >35 kg/m² ist eine Fettabsaugung unzulässig; hier soll zunächst die Adipositas behandelt werden. Ist das Gewicht dann über sechs Monate stabil, kann eine Liposuktion in Erwägung gezogen werden.
- Bei BMI-Werten zwischen 32 kg/m² und 35 kg/m² darf eine Liposuktion nur bei einer Waist-to-Height-Ratio (WHtR) unterhalb der altersentsprechenden Grenzwerte stattfinden: 40 Jahre und jünger: 0,5; 41 bis 49 Jahre: Anstieg um 0,01 je weiteres Lebensjahr; 50 Jahre und älter: 0,6.
- Bei der Anamneseerhebung sollen psychische Faktoren, die im Zusammenhang mit dem Krankheitsbild eine Rolle spielen können, erfasst werden.
Indikationsstellung und Liposuktion selbst finden dann bei Fachärztinnen und Fachärzten für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie, anderen Fachärztinnen und Fachärzten des Gebiets Chirurgie sowie Fachärztinnen und Fachärzten für Haut- und Geschlechtskrankheiten statt.
Diese Trennung zwischen Fachärzten für die Diagnose sowie Fachärzten für Indikation und Eingriff war den G-BA-Vertretern sehr wichtig. Denn in der Studie sei es auffällig gewesen, dass bei der Erstbegutachtung zunächst viele Frauen als infrage kommend eingestuft worden sind, die dann bei der Zweitbegutachtung doch rausgefallen seien, erklärte Vorsitzender Hecken in der Sitzung.
EBM-Ziffern zum 1. Januar 2026 in Sicht?
Das Bundesgesundheitsministerium prüft den Beschluss nun. Wird er nicht beanstandet, tritt er einen Tag nach Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft. Danach hat der Bewertungsausschuss sechs Monate Zeit, den EBM anzupassen.
Der G-BA geht eigenen Angaben zufolge davon aus, dass die EBM-Ziffern bis zum 1. Januar 2026 feststehen werden.
Angestoßen hatte das Beratungsverfahren die Patientenvertretung im G-BA. Wegen der problematischen Studienlage hatte der G-BA den Beschluss gefasst, die Bewertung auszusetzen und im Februar 2021 eine Studie zur Verbesserung der Erkenntnislage auf den Weg gebracht.
“Der Leidensdruck der Betroffenen war dem G-BA von Anfang an sehr bewusst”, unterstreicht G-BA-Mitglied van Treeck zum nun finalen Beschluss noch einmal. “Eine frühere Entscheidung zum regulären und unbefristeten Leistungsanspruch war aber nicht möglich, da in die gesetzliche Krankenversicherung nur neue Leistungen im ambulanten Bereich aufgenommen werden dürfen, deren medizinischer Nutzen belegt ist.” Dies sei erst mit den jetzt vorliegenden Ergebnissen von LIPLEG der Fall.