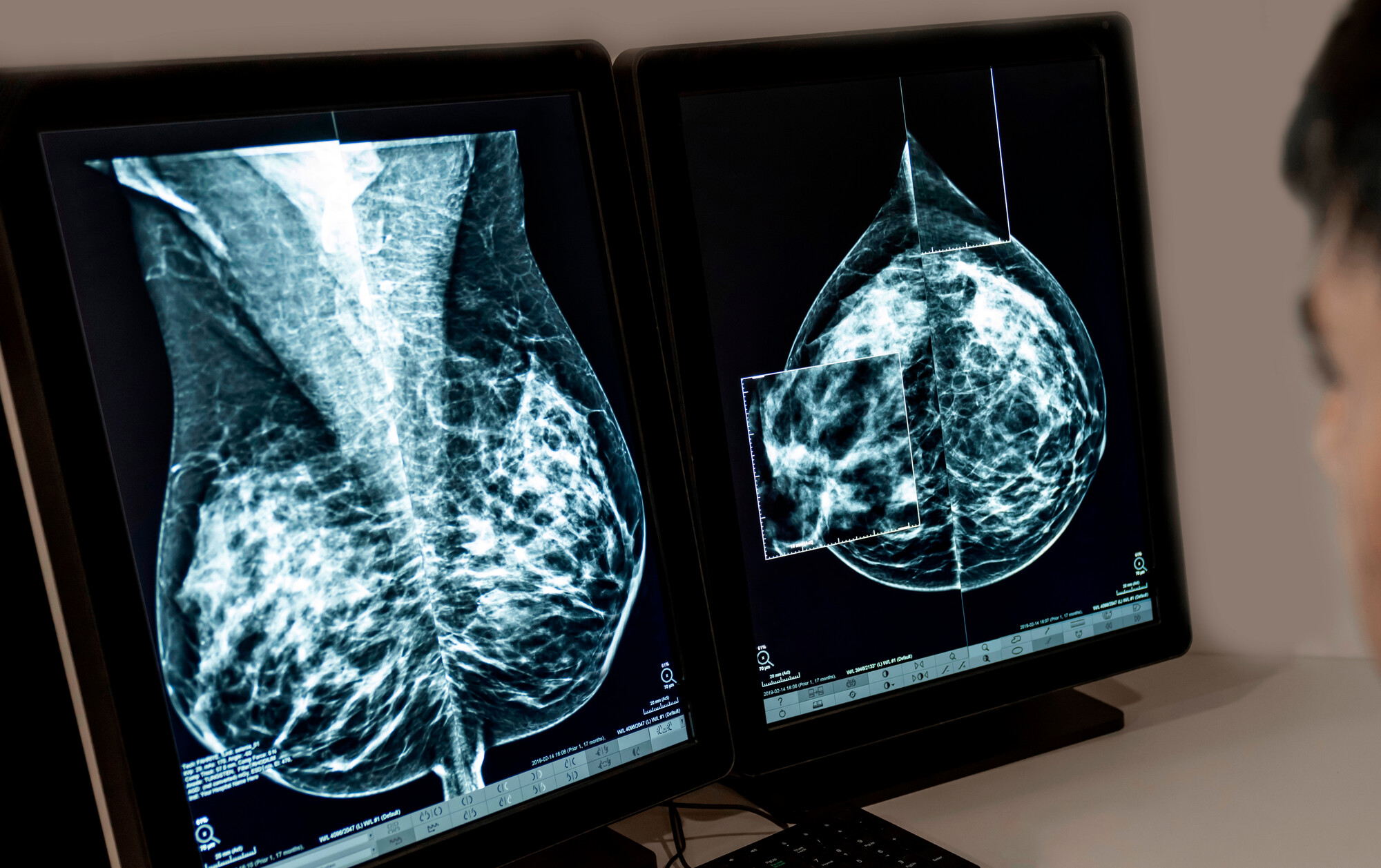Rezidivierende Harnwegsinfekte in der Praxis
Treten unkomplizierte Harnwegsinfekte (HWI) bei Frauen häufiger als zweimal in sechs Monaten oder dreimal im Jahr auf, sprechen wir von einem rezidivierenden Harnwegsinfekt (rUTI). Die effektivste Therapie, um Rezidive zu verhindern, ist eine antibiotische Prophylaxe; diese hat jedoch Nachteile (Nebenwirkungen, Resistenzentwicklung).
Diagnostisch empfehlen Leitlinien eine Urinkultur. Eine Studie in Wales hat nun untersucht, wie viele Frauen betroffen sind und wie eine antibiotische Prophylaxe durchgeführt wird. Dabei nutzten die Forschenden Gesundheitsdatenbanken, die circa 86 Prozent der Bevölkerung erfassen.
6 Prozent der erwachsenen Frauen erfüllten die Kriterien für einen rUTI; 1,7 Prozent wurden prophylaktische Antibiotika verordnet. Frauen zwischen 58 und 67 Jahren waren besonders häufig betroffen. Von den Frauen, die prophylaktische Antibiotika einnahmen, erfüllte jedoch nur circa die Hälfte zuvor die Kriterien für rUTI.
Bei 80 Prozent der Frauen mit rUTI wurde eine Urinkultur durchgeführt, die in 28 Prozent einen HWI bestätigte. E. coli waren die häufigsten Keime, nennenswerte Resistenzen wurden nur für Amoxicillin und Trimethoprim festgestellt. Nur ein Teil der Frauen, die eine antibiotische Prophylaxe erhielten, hatte zuvor einen durch Urinkultur bestätigten HWI.
Bei 18,5 Prozent der Frauen, die Trimethoprim als Prophylaxe einnahmen, wurde in der Urinkultur zuvor ein gegen Trimethoprim resistenter Keim nachgewiesen. Ein zielgerichteter Einsatz der antibiotischen Prophylaxe wäre wünschenswert.
Fazit: Eine antibiotische Prophylaxe bei rezidivierendem Harnwegsinfekt sollte wegen Nebenwirkungen und Resistenzentwicklung sorgfältig unter klinischen Aspekten und nach den Ergebnissen der Urinkultur abgewogen und ein passendes Antibiotikum gezielt eingesetzt werden.
Quelle: Sanyaolu L et al. Recurrent urinary tract infections and prophylactic antibiotic use in women: a cross-sectional study in primary care. Br J Gen Pract. 2024 Aug 29;74(746):e619-e627. doi: 10.3399/BJGP.2024.0015
Mirtazapin bei COPD
Luftnot ist sehr belastend und tritt bei fortgeschrittener COPD oder interstitiellen Lungenerkrankungen regelhaft auf. Eine niedrig dosierte Morphingabe ist eine gängige Therapie, obwohl die Evidenz dafür begrenzt ist [1]. Weitere Therapieoptionen wären daher wünschenswert. Mirtazapin schien in vorausgehenden Laboruntersuchungen und ersten klinischen Studien Luftnot bei diesen Erkrankungen zu lindern. Auch erscheint es schlüssig, dass die angstlösende Wirkkomponente bei Dyspnoe hilfreich sein kann.
Eine randomisierte, multizentrische Studie in acht Ländern untersuchte nun, ob die Einnahme von Mirtazapin das Symptom Luftnot verbessert. Für die Studie wurden 2.499 Personen gescreent. 557 erfüllten die Einschlusskriterien (COPD-Diagnose, Luftnot 3-4 auf der MRC-Breathlessness-Skala, keine bestehende Einnahme von Antidepressiva); 225 von ihnen waren mit der Teilnahme einverstanden.
Die Teilnehmenden erhielten entweder Mirtazapin oder Placebo. Nach 14 und 18 Tagen konnte die Dosis je um eine Tablette bis maximal 45 mg Mirtazapin oder 3 Placebotabletten erhöht werden. An Tag 56 gaben die Teilnehmenden die schlimmste Luftnot auf einer numerischen Skala von 1-10 an. Die Luftnot an Tag 56 unterschied sich in den beiden Gruppen nicht und lag gleichbleibend bei Werten zwischen 6 und 7.
Auch sekundäre Endpunkte unterschieden sich nicht. In der Mirtazapin-Gruppe traten etwas mehr Nebenwirkungen auf. Auch in ergänzenden qualitativen Interviews fand sich kein Hinweis auf eine Linderung von Beschwerden durch Mirtazapin. Die Interviewten berichteten aber über medikationsunabhängige Schwankungen des Befindens. Interessant ist, dass über die Hälfte der Patienten, die die Einschlusskriterien erfüllten, nicht teilnehmen wollten, am häufigsten, weil sie kein Mirtazapin einnehmen oder grundsätzlich nicht in Forschung involviert werden wollten.
In der Diskussion wird dargestellt, dass Studien auch die Unwirksamkeit anderer Antidepressiva zeigen [2,3] und diese Medikamentengruppe möglicherweise insgesamt keine wirksame Therapieoption bei Luftnot darstellt. Die Studiengruppe betont die Wichtigkeit von Studien für palliative Situationen, auch um die Verordnung von unwirksamen Medikamenten mit Nebenwirkungspotenzial zu reduzieren. Allerdings zeigt diese Studie durch die geringe Teilnahmebereitschaft, wie schwierig die Umsetzung sein kann.
Fazit: Mirtazapin bzw. möglicherweise auch Antidepressiva generell lindern bei fortgeschrittenen Lungenerkrankungen das Empfinden von Luftnot nicht, können aber Nebenwirkungen mit sich bringen.
Quelle: Higginson IJ et al. Mirtazapine to alleviate severe breathlessness in patients with COPD or interstitial lung diseases (BETTER-B): an international, multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 mixed-method trial. The Lancet Respiratory Medicine, Volume 12, Issue 10, 763 – 774. doi: 10.1016/S2213-2600(24)00187-5
Literatur:
- Barnes H et al. Opioids for the palliation of refractory breathlessness in adults with advanced disease and terminal illness. Cochrane Database Syst Rev 2016; 3: CD011008.
- Currow DC et al. Sertraline in symptomatic chronic breathlessness: a double blind, randomised trial. Eur Respir J 2019; 53: 1801270.
- Ström K et al. Effect of protriptyline, 10 mg daily, on chronic hypoxaemia in chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J 1995; 8: 425–9.
Best of Leitlinien
mit Prof. Dr. med. Markus Bleckwenn, Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig und hausärztlich in Linz am Rhein tätig.
Was ist Ihre Lieblingsleitlinienempfehlung? Und warum?
Meine Lieblingsleitlinienempfehlung stammt aus der DEGAM-Leitlinie “Erhöhter TSH-Wert in der Hausarztpraxis”: “Bei Dauertherapie mit unklarer Indikation sollte ein kontrolliertes Absetzen der Ersatztherapie (Levothyroxin (LTX)) unter Beachtung der Patienteninteressen erwogen werden”.