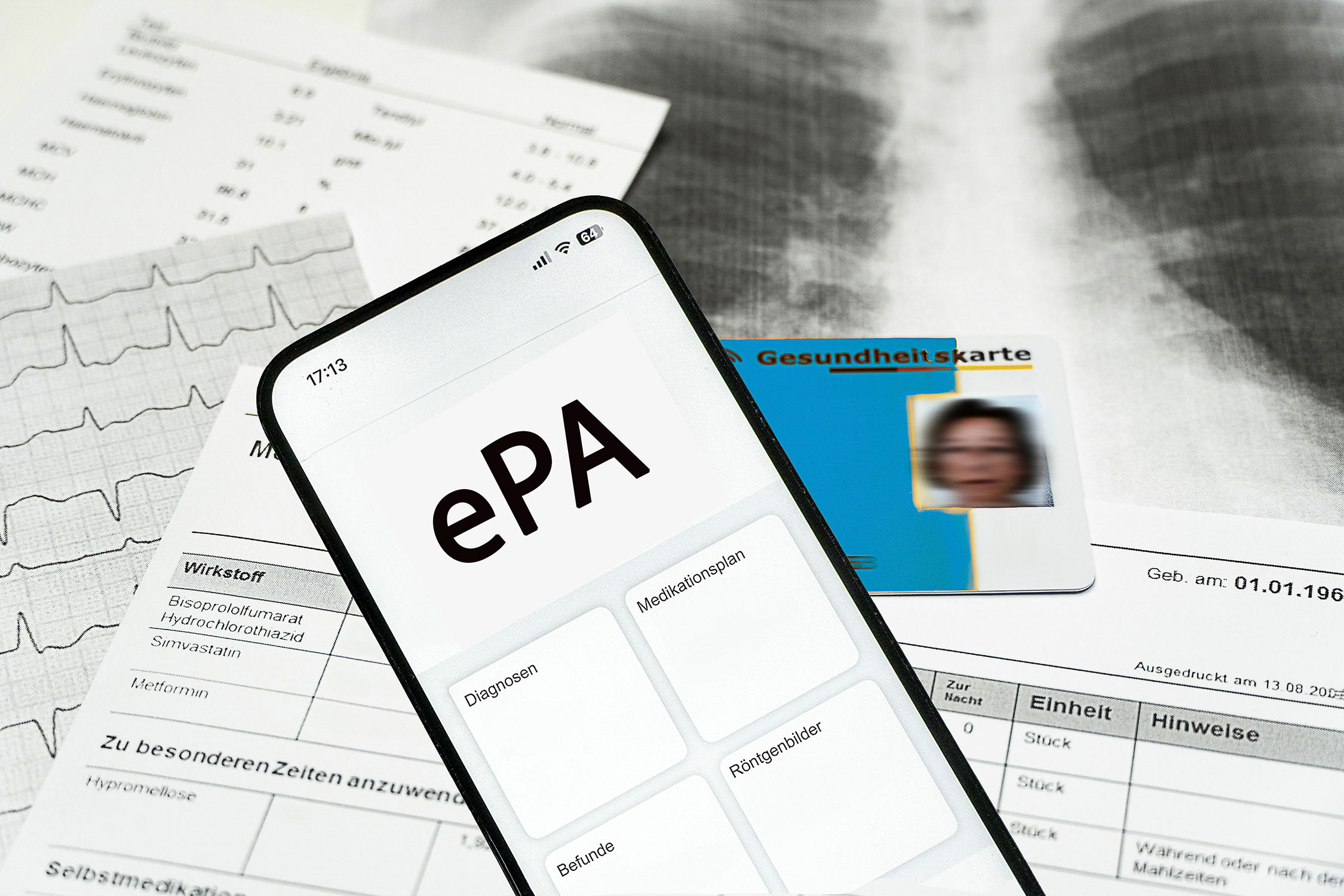Für die Behandlung von Menschen mit Long-Covid oder Verdacht auf Long-Covid sind zum 1. Januar mehrere neue Leistungen in den EBM aufgenommen worden. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und der GKV-Spitzenverband haben im Dezember dazu einen entsprechenden Beschluss gefasst und die Vergütung festgelegt.
Insgesamt wurden fünf neue Gebührenordnungspositionen (GOP) in den EBM aufgenommen, unter anderem für ein Basis-Assessment und für Fallbesprechungen (mehr zu den neuen Ziffern: www.hausarzt.link/YW4vA). Alle Leistungen werden zunächst extrabudgetär vergütet.
5 neue EBM-Ziffern
- 37800 EBM: Basis-Assessment (20,33 Euro)
- 37801 EBM: Zuschlag zur 37800 bei schweren Fällen (15,86 Euro)
- 37802 EBM: Zuschlag zur Versicherten-/Grundpauschale (17,47 Euro)
- 37804 EBM: Förderung von Fallbesprechungen (10,66 Euro)
- 37806 EBM: Spezialisierte ambulante Versorgung (27,14 Euro)
Die Long-Covid-Richtlinie (Long-COV-RL) des Gemeinsamen Bundesausschusses ist bereits im Mai 2024 in Kraft getreten. Sie soll die Versorgung von Menschen mit Long-Covid strukturieren und verbessern. Im folgenden finden Sie noch einmal die wichtigsten Punkte zusammengefasst.
Definition der Patientengruppe
In der Richtlinie wird Long-Covid definiert als
- ein post-akut anhaltendes oder neu auftretendes Symptom oder Krankheitsbild oder mehrere solcher Symptome oder Krankheitsbilder in Folge einer akuten Sars-CoV-2-Infektion bezeichnet, die länger als vier Wochen nach Infektion andauern oder ab einer Zeit von vier Wochen nach Infektion auftreten.
- Hierzu werden auch Folgen einer akuten Sars-CoV-2-Infektion gezählt, die als Post-Covid bezeichnet werden und länger als 12 Wochen (bei Kindern und Jugendlichen nach acht Wochen) nach Infektion andauern oder neu auftreten.
- Von der Richtlinie werden außerdem Menschen erfasst, die infolge einer Corona-Infektion den Verdacht oder die Diagnose ME/CFS oder nach einer Corona-Impfung Long-Covid-ähnliche Symptome aufweisen (“Post-Vac-Symptome”).
- Laut Richtlinie zählen zur Long-Covid-Patientengruppe zudem Menschen mit Verdacht auf oder mit einer festgestellten Erkrankung, die eine ähnliche Ursache oder eine ähnliche Erkrankungsausprägung wie Long-Covid aufweist. In diesem Sinne werden auch Menschen aller Altersgruppen erfasst, die infolge einer Infektion post-akut eine der Long-Covid-Erkrankung ähnliche Symptomatik oder eine ME/CFS haben.
Die Diagnosestellung erfolgt leitlinienbasiert beziehungsweise nach aktuellem Stand der medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnisse auf Basis einer symptomorientierten differenzialdiagnostischen Abklärung oder als Ausschlussdiagnose, heißt es in der Richtlinie.
Stufenmodell für die Versorgung bei Long-Covid
Die Betroffenen sollen nach einem Stufenmodell versorgt werden. Erste Anlaufstelle sind in der Regel Hausärztinnen und Hausärzte beziehungsweise Kinder- und Jugendärzte, gefolgt von einer fachärztlichen Versorgung bis hin zu einer spezialisierten ambulanten Versorgung (z.B. Hochschulambulanzen).
Welche Diagnostik in der hausärztlichen Versorgung?
Basisassessment:
- Ausführliche, strukturierte Anamnese einschließlich Impfanamnese und Erfassung häufiger Symptome sowie mutmaßlichem Trigger, Zeitpunkt des Auftretens und Dauer der Symptome einschließlich Fatigue, Belastungsintoleranz, orthostatische Intoleranz (OI), Dyspnoe, Schmerz, Schlafstörungen und psychischer Status.
- Ausführliche körperliche Untersuchung mit Erfassung des neurologischen und Ernährungsstatus (inklusive BMI), unter Berücksichtigung von Vorerkrankungen und Komorbiditäten.
- Erfassung des funktionellen Status anhand etablierter Skalen sowie der Einschränkungen der Teilhabe der Betroffenen.
- Bei hinweisender Symptomatik: strukturierter Ersterfassung einer möglichen OI und/oder einer Post-exertionellen Malaise (PEM) und/oder eines posturalen orthostatischen Tachykardiesyndroms (POTS).
Weitere Aufgaben:
Für die Betroffenen sind Hausärztinnen und -ärzte die ersten Ansprechpartner, sie informieren, beraten, betreuen und klären Betroffene oder ihre Bezugspersonen über das Krankheitsbild und die spezifischen Symptome auf, fasst die Richtlinie zusammen.
Eine ganz wesentliche Aufgabe des Hausarztes oder der Hausärztin ist zudem die Koordination der Versorgung und die Veranlassung notwendiger Überweisungen sowie Leistungen, dazu gehört auch das Erstellen eines Behandlungsplans.
Dieser Behandlungsplan umfasst beispielsweise die Zusammenführung, Bewertung, Dokumentation und Aufbewahrung der wesentlichen Behandlungsdaten, Befunde und Berichte. Der Behandlungsplan sowie die Behandlungsziele sollen mit dem Patienten oder der Patientin abgestimmt und ihnen in Textform zugänglich gemacht werden.
Wann überweisen?
Eine Überweisung zur Mit- oder Weiterbehandlung in die fachärztliche Versorgung oder in die spezialisierte ambulante Versorgung, soweit kein fachärztlicher Überweisungsvorbehalt besteht, ist laut Richtlinie besonders dann erforderlich, wenn bei einer Patientin oder einem Patienten
- Symptome neu auftreten, unter Behandlung fortbestehen oder sich verschlechtern oder
- bei Warnhinweisen: schlechter Allgemeinzustand, signifikante Gewichtszu- bzw. -abnahme, unerklärliche oder neu aufgetretene neurologische Auffälligkeiten (wie Sensibilität, Motorik, Schlucken, Sprache und Kognition), neue Schmerzsymptomatik, schlechte oder sich verschlechternde somatische oder psychische Befunde sowie unerklärliche Auffälligkeiten in der Basisdiagnostik.