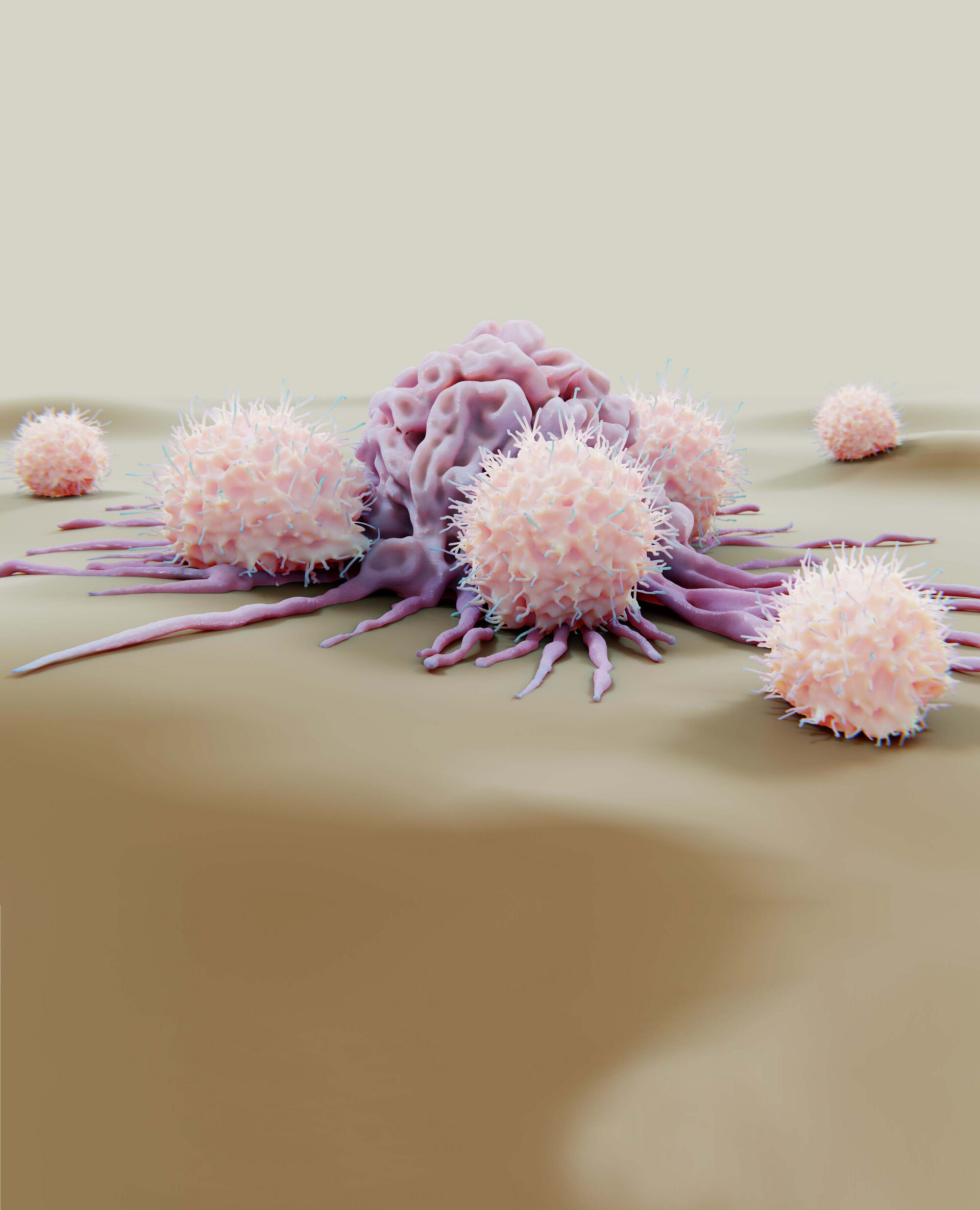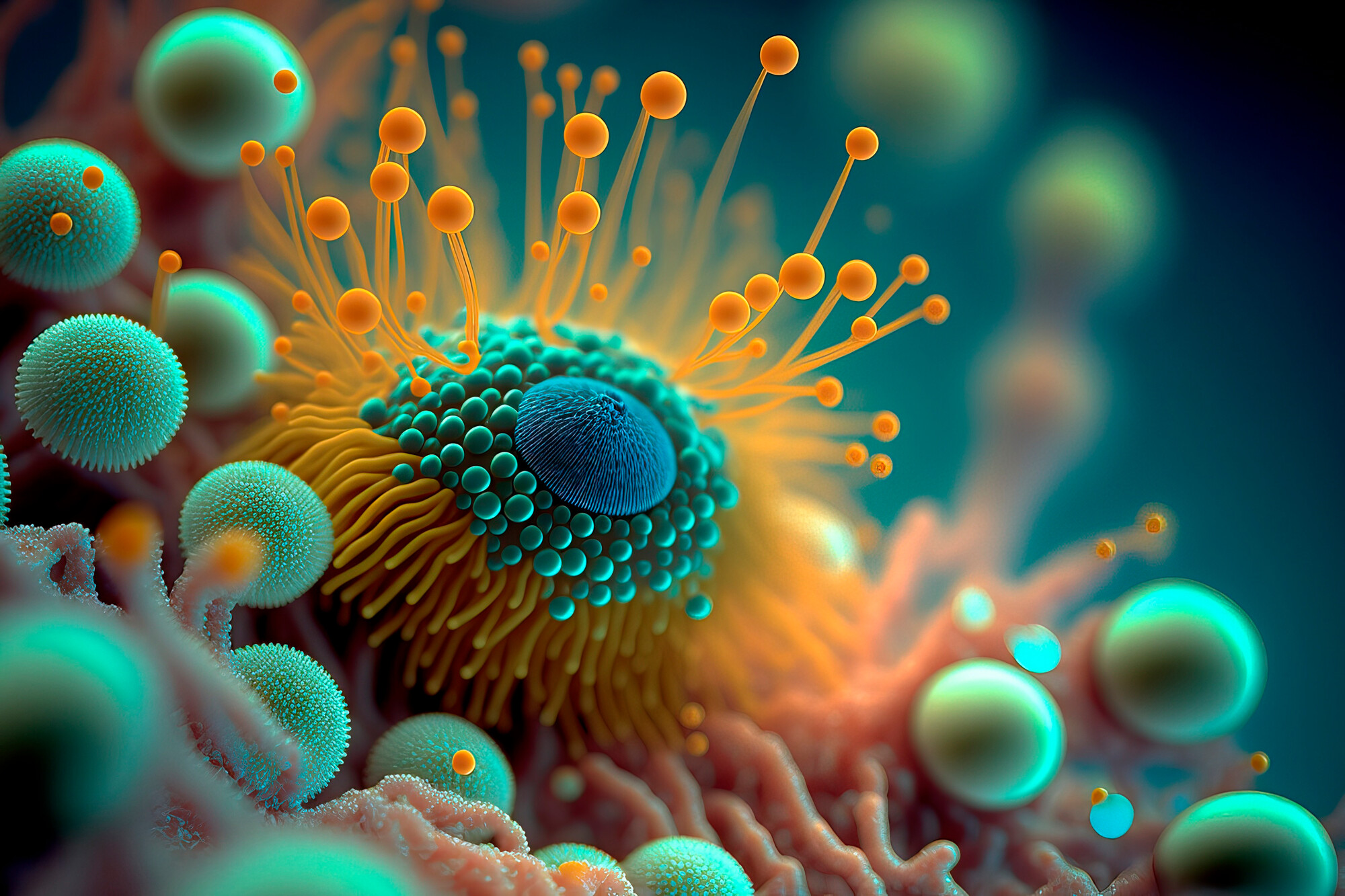© Kaiser
© KaiserPriv.-Doz. Florian Kaiser ist Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie sowie Palliativmediziner. Er arbeitet in einem Medizinischen Versorgungszentrum in Landshut.
Orale Therapien werden bei einigen soliden Tumoren – Beispiele sind Gallenblasenkarzinome, bestimmte nicht-kleinzellige Bronchialkarzinome (NSCLC), Kolon- oder auch Magenkarzinome – aber mittlerweile auch bei vielen hämatologischen Erkrankungen immer wichtiger. Beispiele sind hier chronische lymphatische Leukämien (CLL) sowie bestimmte Lymphome.
Um welche Substanzen handelt es sich hier?
Das sind zum einen Vertreter der klassischen Chemotherapie wie Trifluridin/Tipiracil und Capecitabin. Zu den oralen zielgerichteten Wirkstoffen gehören Venetoclax sowie Ibrutinib, die bei hämatologischen Erkrankungen wie CLL oder Mantelzell-Lymphom (MCL) angewendet werden.
Wie hoch sind die Ansprechraten auf orale Tumortherapien?
Das hängt naturgemäß sehr stark vom Tumor und vom Stadium der Erkrankung ab. Sehr gute Erfolge mit einer oralen Therapie sehen wir bei der CLL. Während man hier früher eine Chemotherapie gab oder sogar über eine Stammzelltransplantation nachdachte, können wir diese Erkrankungen heute oft mit oralen Therapien sehr gut beherrschen, teilweise zeitlich begrenzt über ein bis zwei Jahre, in einigen Fällen aber auch langfristig.
Ein Beispiel für solide Tumoren sind bestimmte Formen des NSCLC, die man heute auch First Line oral zum Teil besser behandeln kann als mit herkömmlicher Chemotherapie und bei denen man manchmal auch in der metastasierten Situation mehrere Jahre gewinnen kann.
Wie ist die Lebensqualität unter solchen Therapien?
Patienten, die zum Beispiel einen oralen TKI gut vertragen, haben oft eine sehr gute Lebensqualität. Dennoch sind, ebenso wie bei der Chemotherapie, regelmäßige Kontrolluntersuchungen auch bei oralen TKI-Therapien notwendig, um frühzeitig Komplikationen zu diagnostizieren. Trotzdem können auch hier sehr schwere Nebenwirkungen auftreten, die zum Abbrechen der Behandlung zwingen.
Mit Immuntherapeutika wie den Checkpoint-Inhibitoren beschreitet man bekanntlich einen schmalen Grat zwischen zu geringer oder überschießender Stimulation der Abwehr. Was sollten Hausärzte darüber wissen?
Wichtig ist vor allem, dass Hausärzte darüber informiert sind, welche onkologischen Therapien ihre Patienten bekommen. Während ihre Aufgabe bei einer klassischen Chemotherapie vor allem in Blutbildkontrollen bestand, geht es bei den neuen Check-Point-Inhibitor-Therapien um das Management eines ganzen Spektrums möglicher immunvermittelter Nebenwirkungen.
Allerdings ist es für Hausärzte kaum möglich, alle Risiken und Nebenwirkungen der zahlreichen Wirkstoffe zu kennen. Entscheidend ist, dass sie bei Hinweisen auf eine ernste Nebenwirkung rasch Kontakt zu den onkologischen Fachkollegen aufnehmen, denn von einer rechtzeitigen Weichenstellung kann das Leben des Patienten abhängen.
Auf welche Nebenwirkungen ist zu achten?
Generelle Alarmsignale sind Fieber beziehungsweise Infektionen, denn alle Tumorpatienten weisen unabhängig von ihrer Therapie eine Immunsuppression auf. Weitere ernstzunehmende Nebenwirkungen sind Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall.
Gerade bei Checkpoint-Inhibitoren können hinter Durchfall, Hautausschlag, Luftnot oder z.B. in selteneren Fällen auch kardiale Beschwerden immunvermittelter Reaktionen stehen. Bei TKI muss man unter anderem auf Hautveränderungen und Organschäden, insbesondere der Leber, achten.
Das bedeutet für die Hausärzte?
Sie müssen neben dem Blutbild die Organfunktionen im Auge behalten – insbesondere die Laborwerte für Leber, Nieren und Schilddrüse. Es ist eine große Erleichterung für die Patienten, wenn sie für diese Kontrollen zu ihrem Hausarzt gehen können und nicht ins oft weit entfernte onkologische Zentrum fahren müssen.
Wichtig ist ferner, sorgfältig auf die von den Patienten geschilderten Symptome zu achten. So kann man im Ernstfall sofort an die onkologischen Fachkollegen weiterleiten oder direkt stationär einweisen. Daher sollten nicht nur die Patienten, sondern auch die Hausärzte die 24-Stunden-Notfallnummer der onkologischen Praxis griffbereit haben.
Was raten Sie Ihren Patienten auf die vermutlich oft gestellte Frage nach “Krebsdiäten”?
Die Vorstellung, dass man einen Tumor durch Weglassen bestimmter Nahrungsmittel aushungern kann, beurteile ich sehr kritisch. Dagegen ist es für den Erfolg einer Tumorbehandlung sehr wichtig, dass die Patienten ausreichend Energie bzw. Kalorien zuführen, um das Gewicht zu halten, und ausreichend mit essenziellen Nährstoffen versorgt werden. Das erreicht man am besten mit einer ausgewogenen, auf Gewichtserhalt gerichteten Kost.