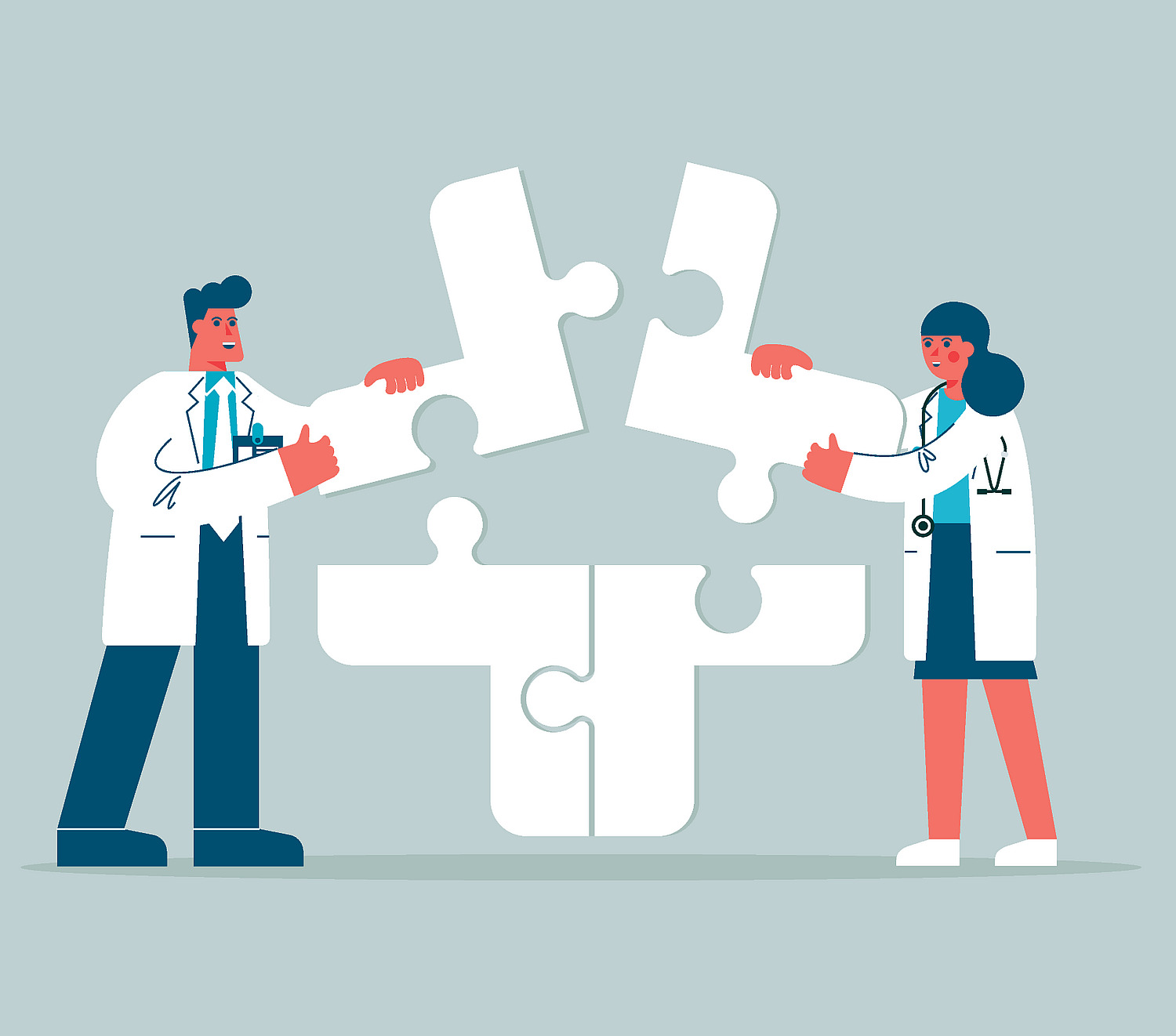Social Media: „good guy“ oder „bad guy“?
Die Folgen von Social Media auf Gehirn und Gesundheit werden kontrovers diskutiert. Dabei wird immer wieder der Verdacht geäußert, Nutzende könnten bei intensivem Gebrauch verdummen oder erkranken. Nach derzeitiger Forschung scheinen die Risiken überschaubar, aber die Datenlage ist noch zu dünn. Grundsätzlich gilt: Medienkompetenz kann auch der Hirngesundheit dienen.
2019 lösten soziale Medien in Deutschland eine soziogene Erkrankung mit funktionellem Tourette-ähnlichem Verhalten (mass social media-induced illness) aus. Damit wurde das Phänomen beschrieben, dass Jugendliche, die krankheitsbezogene Inhalte von Influencern betrachteten, selbst die Symptome entwickelten und sich in den sozialen Medien als Betroffene outeten.
Zu den am häufigsten reproduzierten Erkrankungen gehörte das Tourette-Syndrom und die dissoziative Identitätsstörung. Daher wurde vermutet, dass soziale Netzwerke neu auftretende Tics begünstigen können. Diskutiert wurde auch, dass eine durch soziale Medien aufgetretene artifizielle Störung im Sinne eines Münchhausen-Syndroms vorliegen könnte. Für einen kausalen Zusammenhang mit einer erhöhten Nutzung sozialer Medien spricht auch, dass während der Covid-19-Pandemie die Zahl funktioneller Tic-ähnlicher Störungen um 60 Prozent erhöht war.
Dieses spektakuläre Beispiel wird immer wieder angeführt, um Gesundheitsgefahren, die von Social Media ausgehen können, zu beschreiben. “Auch wenn während der Pandemie ein Anstieg beim Tourette-Syndrom zu beobachten war, bleibt zu konstatieren: Die absoluten Zahlen waren und sind gering. “Das ist nichts, was die Neurologen sorgenvoll stimmt”, so Prof. Lars Timmermanns, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Neurologie. Funktionelle neurologische Störungen würden bei 15 Prozent der Vorstellungen in neurologischen Sprechstunden diagnostiziert.
Es wurden aber auch neuropsychiatrische Folgen des übermäßigen Mediengebrauchs berichtet. Neue Daten sprechen dafür, dass lange Bildschirmzeiten bei Kindern mit Störungen wie Angst, Somatisierung und Depression assoziiert sind, aber mit einer nur geringen Effektstärke. Auch kann es zu Schlafstörungen kommen.
Nicht vergessen sollte man, dass von sozialen Medien auch ein gesundheitlicher Mehrwert ausgehen kann. Sie können Impulse für einen gesunden Lebensstil setzen, etwa durch Anregungen zu einer gesünderen Ernährung und mehr Sport.
Eine koreanische Studie hat gezeigt, dass sich bei Personen mit problematischem Social-Media-Gebrauch die Hirnkonnektivität verändert. Sie fand eine engere Verbindung zwischen Sehrinde und intraparietaler Hirnrinde und eine geschwächte Verbindung zwischen diesen Arealen und denen für soziale Einordnung, die für die emotional-kognitive Wertung wichtig sind.
Zusammengefasst, so Timmermann, seien die sozialen Medien weder ein “good guy” noch ein “bad guy”. Richtig angewendet, machen sie weder krank noch “dumm”. Sie können vielmehr die funktionelle Konnektivität und Plastizität des Gehirns erhöhen. Das Potenzial könne man therapeutisch nutzen, etwa nach einem Schlaganfall, traumatischen Hirnverletzungen oder bei neurodegenerativen Erkrankungen.
Antikörper gegen Alzheimer
“Betroffene warten auf die neue Therapieoption”, sagte Prof. Peter Berlit, Essen, über den Antikörper Lecanemab. Auch wenn damit die Erkrankung nicht geheilt werde, so werde die Progression der Erkrankung um etwa ein Drittel gehemmt: Betroffene blieben also etwa 1,5 Jahre statt einem Jahr im Frühstadium, zeigten Zulassungsstudien. Die Zulassung in der EU stand bei Redaktionsschluss aber noch aus.
Im Januar war die EU-Kommission nicht der Empfehlung der EMA gefolgt, sondern hat erneut den Ausschuss für Humanarzneimittel CHMP um die Bewertung von Daten gebeten, die nach der EMA-Empfehlung im November 2024 veröffentlicht wurden.
Da die neue Therapie nur in Frühstadien wirke, sei es wichtig, Menschen für erste Krankheitszeichen zu sensibilisieren, so Berlit. Andere Neurologen schätzen den Anwenderkreis aber als begrenzt ein.
So profitieren Frauen nach bisherigen Daten weniger als Männer. Und die Behandlung kann schwere Nebenwirkungen (Schwellungen und Blutungen im Gehirn) haben, weswegen auch die EMA einige Personen von der Therapie ausschließen würde (mehr dazu: www.hausarzt.link/sT8oq). (mit jvb)
Alkohol schädigt Nerven und Gehirn
Alkohol ist eine gesellschaftlich akzeptierte Droge, auch wenn der Mythos vom “gesunden Gläschen in Ehren” nach aktuellen wissenschaftlichen Daten nicht mehr zu halten ist. Laut Angaben des Bundesministeriums für Gesundheit konsumieren 7,9 Millionen Menschen Alkohol in gesundheitlich riskanter Menge.
Auch wenn der Trend offensichtlich zu weniger hochprozentigen alkoholischen Getränken geht, so ist der Konsum insgesamt zu hoch, zu regelmäßig und offensichtlich zu unbedacht. Von einem riskanten Konsum spricht man, wenn durchschnittlich mehr als 12 g reiner Alkohol von Frauen bzw. 24 g von Männern pro Tag konsumiert wird.
Unbestritten schädigt der Alkohol die Nerven und das Gehirn und dies schon in geringen Mengen. “Neue wissenschaftliche Daten haben den Mythos “ein bisschen Alkohol” sei besser als eine strikte Abstinenz, widerlegt”, so Prof. Frank Erbguth, Nürnebrg.
Die neurotoxische Wirkung von Alkohol wird über verschiedene Wirkweisen vermittelt. Das ist einmal der Thiaminmangel. Auch behindert Alkohol die Fähigkeit der Zellen, Thiamin zu verwerten, und führt zu einer vermehrten Bildung von Acetaldehyd, einem Zellgift, d.h. es kommt zu einer neuronalen Degeneration.
Darüber hinaus induziert Alkohol einen Entzündungsprozess, man spricht von einer Neuroinflammation, die einen weiteren neurotoxischen Faktor darstellt. Und wenn es durch Alkoholmissbrauch zu einer Leberschädigung kommt, entstehen weitere neurotoxische Faktoren. Zu den häufigen Alkohol-induzierten Folgeerkrankungen gehört auch die Polyneuropathie. Bei jedem fünften Betroffenen mit einer Polyneuropathie ist diese alkoholbedingt.