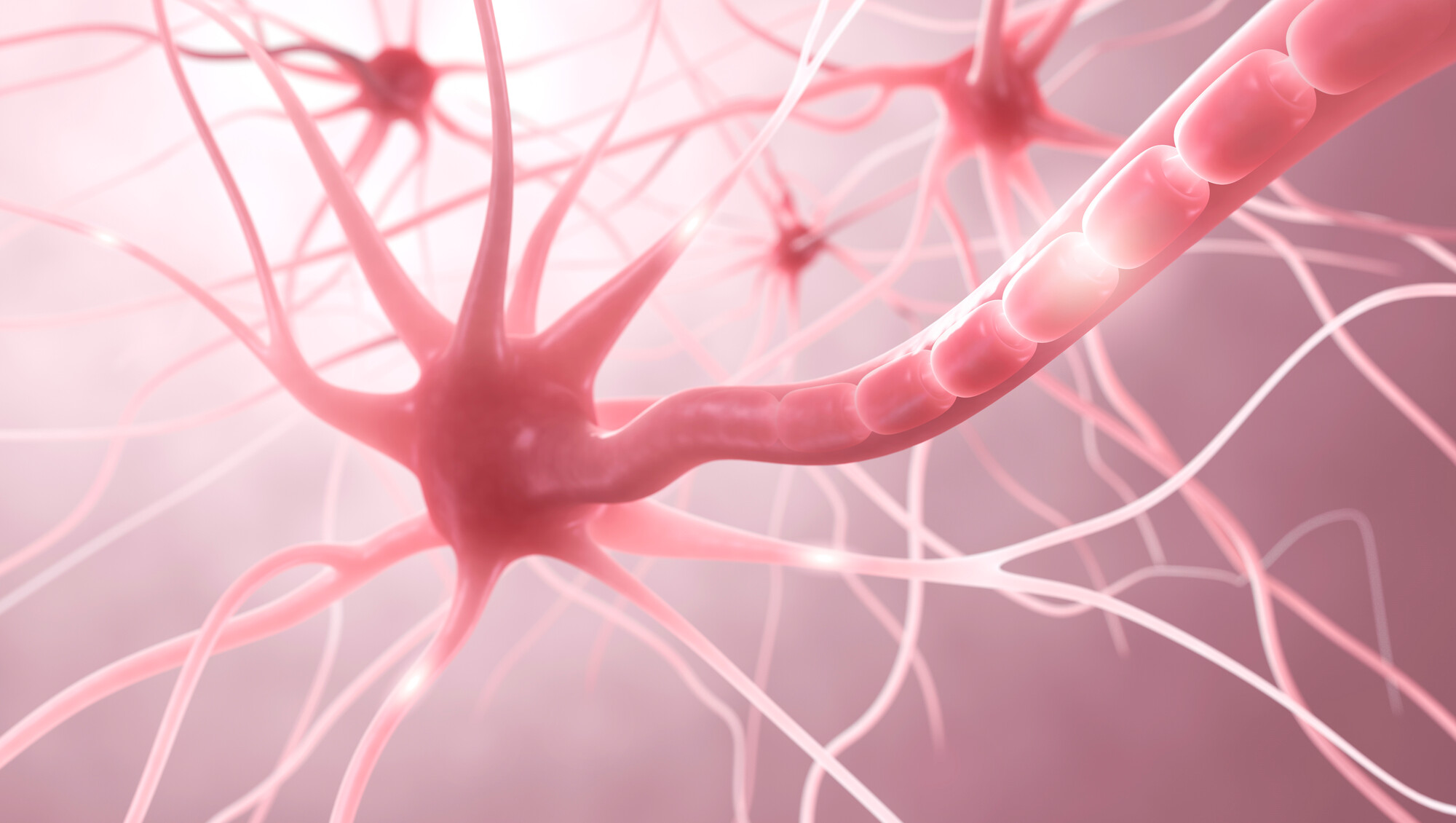Verbesserungspotenzial bei chronischen Schmerzen
Die Versorgungsstrukturen in Deutschland werden Menschen mit chronischen Schmerzstörungen nicht gerecht. Ein Problem sind dabei unter anderem die ‚Sektorengrenzen‘, die zwischen spezialisierten ambulanten, teilstationären und stationären Einrichtungen bestehen. Darüber hinaus befinden sich die Einrichtungen teilweise weit weg von den Wohnorten der Betroffenen und haben oft monatelange Wartezeiten.
Derzeit erreicht die aktuelle schmerztherapeutische Regelversorgung insbesondere die bis zu vier Millionen Betroffenen mit chronischen Schmerzen und bereits schwerer körperlicher und psychosozialer Beeinträchtigung. Doch deutlich mehr Patientinnen und Patienten (ca. 23 Millionen) klagen über chronische oder anhaltende Schmerzen und laufen Gefahr, dass sich ihre Schmerzen verschlimmern oder chronifizieren. Erforderlich ist daher ein abgestuftes, sektorenübergreifendes Versorgungssystem, das den Zugang zu hochwertiger Schmerztherapie sicherstellt.
Auch die Sichtweise auf die Schmerzerkrankungen selbst sollte sich verändern und dem ‚Leitsymptom Schmerz‘ mehr Beachtung als eigenes Krankheitsbild zukommen. Das komplexe Krankheitsbild chronischer Schmerzen erfordert einen bio-psycho-sozialen Therapieansatz und ist in der Regel nicht mit einer monomodalen Therapie wie einer Operation oder einer Tablette in den Griff zu bekommen. Vielmehr ist eine gezielte interdisziplinäre Behandlung erforderlich.
Einen hoffnungsvollen Ansatz stellen Innovationsfondsprojekte dar, die neue Versorgungsformen etablieren möchten und das Ziel verfolgen, die Betroffenen so früh wie möglich in eine gute, angemessene, interdisziplinäre Schmerztherapie zu führen, um eine Chronifizierung zu verhindern.
Um die ambulante Versorgung zu verbessern, wurden unter anderem die Projekte PAIN2020 und PAIN2.0 gestartet. Werden diese Projekte abschließend positiv bewertet, haben sie die Chance, in die Regelversorgung überzugehen. Erste Ergebnisse zeigen, dass die Ansätze funktionieren, allerdings wird es noch längere Zeit dauern, bis sie im Alltag ankommen. (Prof. Frank Petzke, Göttingen)
Mehrheit fühlt sich stigmatisiert
Eine nicht repräsentative Umfrage unter und 1.200 Menschen mit einer neurologischen und/oder einer Schmerzerkrankung brachte ein eindeutiges Ergebnis: 90,9 Prozent der Befragten fühlen sich stigmatisiert, fast alle aufgrund ihrer Schmerzen. Als häufigste Krankheitsbilder der überwiegend weiblichen (90,7 Prozent) Teilnehmenden, die meist zwischen 55 und 64 Jahren alt waren, wurden Fibromyalgie, chronische Schmerzen und Migräne angegeben.
Mangelndes Verständnis und Wissen über die Krankheit sowie deren Unsichtbarkeit wurden als Hauptursache für Stigmatisierung angesehen. Alarmierend ist, dass 83,7 Prozent der Betroffenen berichteten, dass schon einmal ein Arzt oder eine andere medizinische Fachkraft ihnen das Ausmaß oder die Schwere ihrer Symptome nicht geglaubt hat.
Ebenfalls über 80 Prozent waren der Ansicht, keine angemessene Behandlung erhalten zu haben, weil sie nicht ernst genommen wurden. Rund 60 Prozent haben einen Arztbesuch hinausgezögert oder vermieden, da sie sich wegen ihrer Erkrankung schämten. Die Vertreter des Arbeitskreises für Patientenorganisationen der Deutschen Schmerzgesellschaft e.V. wünschen sich daher mehr Maßnahmen zur Vermeidung und dem Umgang mit Stigmatisierung. (Heike Norda, Neumünster)
DIGA begleitend einsetzen
Die Zeit für den einzelnen Patienten ist in der hausärztlichen Praxis knapp bemessen, durchschnittlich dauert ein Arzt-Patient-Kontakt 7,6 Minuten. Für eine umfassende Beratung bleibt da nicht viel Zeit. Durch digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) lassen sich persönliche Gespräche zwar nicht ersetzen, sie können jedoch ergänzend eingesetzt werden – beispielsweise bei Depressionen, Angst- und Panikstörungen, die häufig begleitend zu Schmerzerkrankungen vorkommen.
Auch für Rückenschmerzen stehen gute Trainingsapps zur Verfügung und im Bereich Kopfschmerzen werden in nächster Zeit weitere verschreibbare DiGA erwartet. Da Schmerzpatienten sehr unter Kontrollverlust und mangelnder Selbstwirksamkeit leiden, können diese Anwendungen den Betroffenen etwas Selbstkontrolle und Selbstwirksamkeit zurückgeben.
Die Anwendungsbereitschaft seitens der Patienten ist relativ gut; unter den DiGA-Nutzern finden sich mehr Frauen als Männer und diese sind mit 50 bis 60 Jahren häufig älter als erwartet. (Prof. Dagny Holle-Lee, Essen)
Schwindel-Migräne ernst nehmen
Migräne muss nicht immer mit Kopfschmerzen einhergehen, die vestibuläre Migräne kann sich auch als Schwindelsymptomatik oder “Betrunkenheitsgefühl” manifestieren, meist assoziiert mit den typischen Migräne Begleitsymptomen wie Licht-, Lärmempfindlichkeit, Übelkeit und Erbrechen. Die vestibuläre Migräne ist die häufigste Schwindelerkrankung der 20- bis 50-Jährigen, bei Frauen in den Wechseljahren kann sie die vorherige Kopfschmerz-Migräne ablösen.
Diese Form der Migräne ist häufig untertherapiert, da die Beschwerden nicht ernst genommen und die Betroffenen in die “psychosomatische Ecke” verwiesen werden. Die vestibuläre Migräne wird wie jede andere Migräne behandelt. (Prof. Dagny Holle-Lee, Essen)
Lipödem – vernachlässigtes Schmerzsyndrom
Das Lipödem ist eine symmetrische, disproportionale Fettverteilungsstörung der Extremitäten und ist immer schmerzhaft – im Gegensatz zur Lipohypertrophie, einer nicht schmerzhaften Fettverteilungsstörung. Die Erkrankung betrifft meist Frauen, die dadurch psychisch stark belastet sind und häufig stigmatisiert werden.
Obwohl die Erkrankung lange bekannt und weit verbreitet ist, fand sie bislang wenig Beachtung. Immerhin wurde Anfang 2024 eine aktuelle Leitlinie dazu publiziert (download unter www.hausarzt.link/FpMxY). (Prof. Joachim Erlenwein, Göttingen)