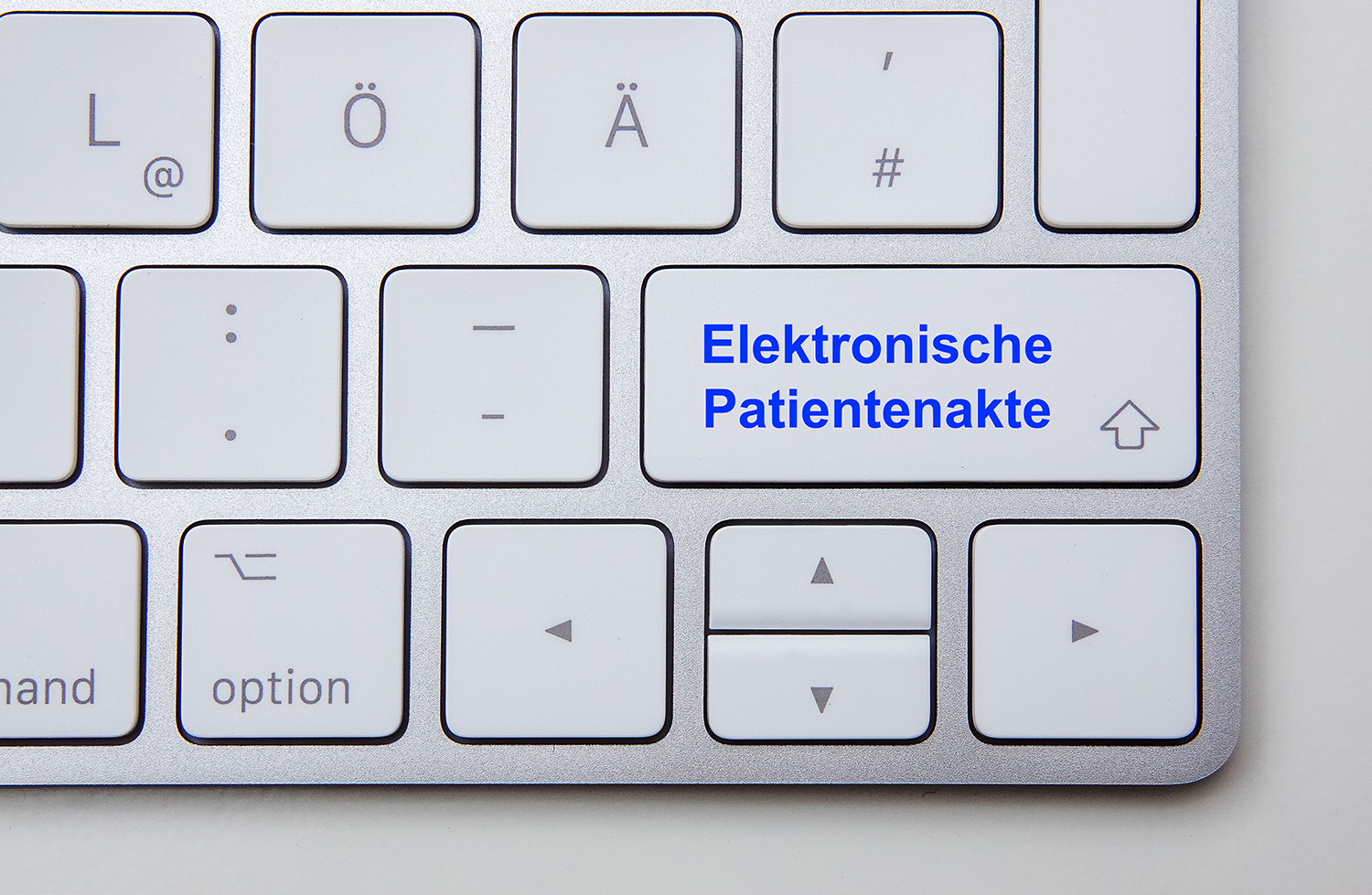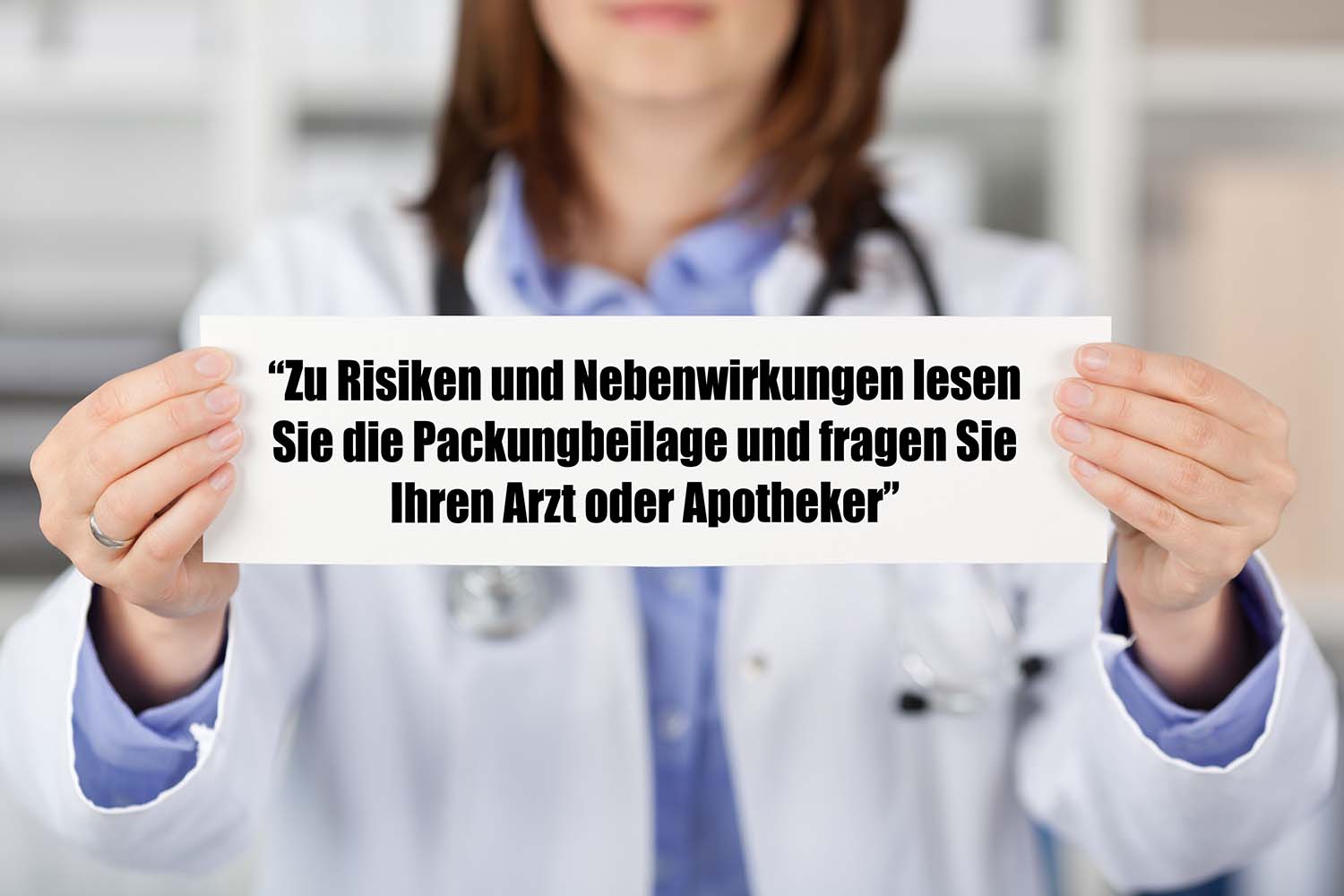Die meisten Patientinnen und Patienten sind erstaunlich offen für ein Gespräch über Sexualität und Prävention. Das zeigte eine anonyme Befragung, in der sich 90,9 Prozent wünschten, dass ihr Arzt oder ihre Ärztin ihnen Fragen zu ihrer Sexualgeschichte stellt, um Ratschläge zur Prävention zu erhalten [1].
Manchen (15 Prozent) wäre die Frage nach ihrer Sexualität zwar peinlich, trotzdem würde die Mehrheit von ihnen (76 Prozent) gerne darüber sprechen. “Das Gefühl von Peinlichkeit – das sich oft auch in der Körpersprache abbildet – bedeutet nicht, dass nicht trotzdem ein Gespräch dazu gewünscht ist”, verdeutlichte Dr. Gregor Eriksen, Berlin, bei einem von der Deutschen Aidshilfe veranstalteten Workshop.
In der Studie wurde jedoch nur jeder vierte bis fünfte Teilnehmende nach vorherigen sexuell übertragbaren Infektionen (STIs), der Anzahl der Sexualpartner und der sexuellen Orientierung gefragt [1].
Anlässe für ein Beratungsgespräch
Eriksen zufolge ist das Thema Sexualität prädestiniert für Ängste und Schamgefühle, welche die Menschen z.B. nach einem Seitensprung umtreiben. In diesen Fällen besteht der Anlass für ein Gespräch oft in der Abklärung eines möglichen Risikos für STIs.
Aber Risiken haben Menschen in allen Lebensaltern, je nachdem wie sie ihre Sexualität leben. Wichtig ist deshalb, das Gespräch auch seitens des Arztes, der Ärztin bei allen Patientinnen und Patienten zu suchen. Egal ob bei jugendlichen MSM (Men who have sex with men) kurz nach dem Coming-out oder älteren Frauen in der Menopause. Denn wenn Menschen nicht von ihrer Infektion wissen, können sie STIs unabsichtlich weitergeben.
Was steht dem offenen Gespräch entgegen?
Hier spielt die eigene Einstellung zur Sexualität eine wichtige Rolle. Wer Sexualität für eine vermeintliche Privatsache hält oder der Ansicht ist, “darüber spricht man nicht”, wird sich schwer damit tun, seine Patientinnen und Patienten darauf anzusprechen. Die eigene Unsicherheit wird laut Eriksen oft als Taktgefühl getarnt, um sich das Thema vom Leib zu halten.
Doch auch die Unsicherheit über den passenden Einstieg sowie fehlende Worte können den Gesprächsbeginn erschweren. Hinderlich sind zudem normative Vorstellungen und Vorannahmen wie beispielsweise: “Im Alter oder mit Behinderung hat man keinen Sex (mehr)” oder “Heterosexualität ist die Norm” sowie Klischees hinsichtlich der Homo- oder Transidentität. “Daher hilft es, sich mit den eigenen Tabuthemen zu beschäftigen und sich zu fragen, ob z.B. bestimmte Praktiken unbewusst bewertet werden”, erklärte Eriksen.
Wer darüber sprechen möchte, sollte sich folglich auch über die eigene Haltung zu fremdartig anmutenden Sexualpraktiken im Klaren sein und seinen Umgang mit dem eigenen (Präventions-)Anspruch überdenken.
Wie Eriksen betonte, “stellt eine akzeptierende Grundhaltung die Basis einer Beratung bzgl. STIs oder anderer Erkrankungen und Störungen im Bereich der Sexualität dar.” Übrigens ist die Bedeutung der eigenen Körpersprache nicht zu unterschätzen – sie verrät den Patientinnen und Patienten viel über die innere Einstellung des Gegenübers.
Kommunikative Brücken bauen
Selten kommen die Patientinnen und Patienten mit dem offen geäußerten Wunsch in die Praxis, über Sexualität zu sprechen. Eher fallen Bemerkungen oder Äußerungen wie: “Sex ist nicht mehr so das Thema für meine Frau und mich…” Diese verbalen Signale lassen sich dann aufgreifen, indem man nachhakt: “Können sie das nochmal erläutern, was meinen sie denn?” Möglich ist auch, die Äußerung empathisch zu spiegeln: “Oft ist es ja etwas unangenehm, darüber zu sprechen…”
Möchte man die Patientinnen und Patienten von sich aus darauf ansprechen, kann man dies im Rahmen der anamnestischen Fragen tun (z.B. “Sind sie sexuell aktiv?”). Laut Eriksen ist es für die Behandelten angenehmer, wenn transparent ist, warum diese Fragen gestellt werden.
Beispielsweise kann man sagen: “Um zu erfahren, wie wir noch besser für Ihre Gesundheit sorgen können, möchte ich das Thema Sexualität ansprechen.” Oder: “Was gibt es sonst noch, das wir heute besprechen können?”
Wertschätzende offene Einstellung vermitteln
Anhand eines beispielhaften Ärztin-Patientin-Gesprächs erarbeiteten die Teilnehmenden des Workshops einige Punkte, die zu einem vertrauensvollen Gespräch beitragen können.
Dabei wurde deutlich, wie wichtig es ist, authentisch zu sein – ohne den ärztlichen Habitus und ohne eine Rolle zu spielen. Selbst etwas aufgeregt oder peinlich berührt zu sein, wirkt in diesem Kontext eher sympathisch und regt zum Sprechen an.
Monologisieren kommt dagegen gar nicht gut an, vielmehr sollte man die Patientinnen und Patienten reden lassen und zuhören. Eriksen riet dazu, im Gespräch einfach mal zu schweigen, um dem Gegenüber Raum zu geben. Auch offene (keinesfalls wertende) Nachfragen sowie authentisches, wertschätzendes Spiegeln des Gesagten schaffen eine vertrauensvolle Atmosphäre.
Die 3-P-Regel erleichtert das Gespräch
Die drei Ps – Partnerinnen/Partner, Praktiken, Prävention – sollten in jedem Gespräch über Sexualität erfragt werden. Als mögliche Einstiegssätze nannte Eriksen: “Um Ihre Gesundheitsrisiken richtig einschätzen zu können” oder “Um Sie bestmöglich versorgen zu können, wäre es hilfreich für mich zu wissen, ob Sie im vergangenen Jahr mehrere Sexpartner oder Sexualpartnerinnen hatten.” Oder: “Mit welchen Menschen hatten Sie (in letzter Zeit) Sex? Mit Männern, Frauen oder beiden?”
Wie Eriksen erläuterte, macht die Benennung der Möglichkeit gleichgeschlechtlicher Partnerinnen oder Partner das Thema “besprechbar”. Auch die Frage nach Praktiken hat nichts mit Neugier zu tun, sondern dient dazu, Risiken einzuschätzen. Bzgl. der Prävention ist auch mal an Vaginalkondome zu denken und danach zu fragen, ob die Prä-Expositions-Prophylaxe (PrEP) bekannt ist.
Literatur:
Quelle: Workshop “Let‘s talk about Sex – reloaded” am 14.5.2025. Förderung der sexuellen Gesundheit und Prävention in der ärztlichen Praxis – ein Online-Kommunikationstraining. Veranstalter: Deutsche Aidshilfe e.V.