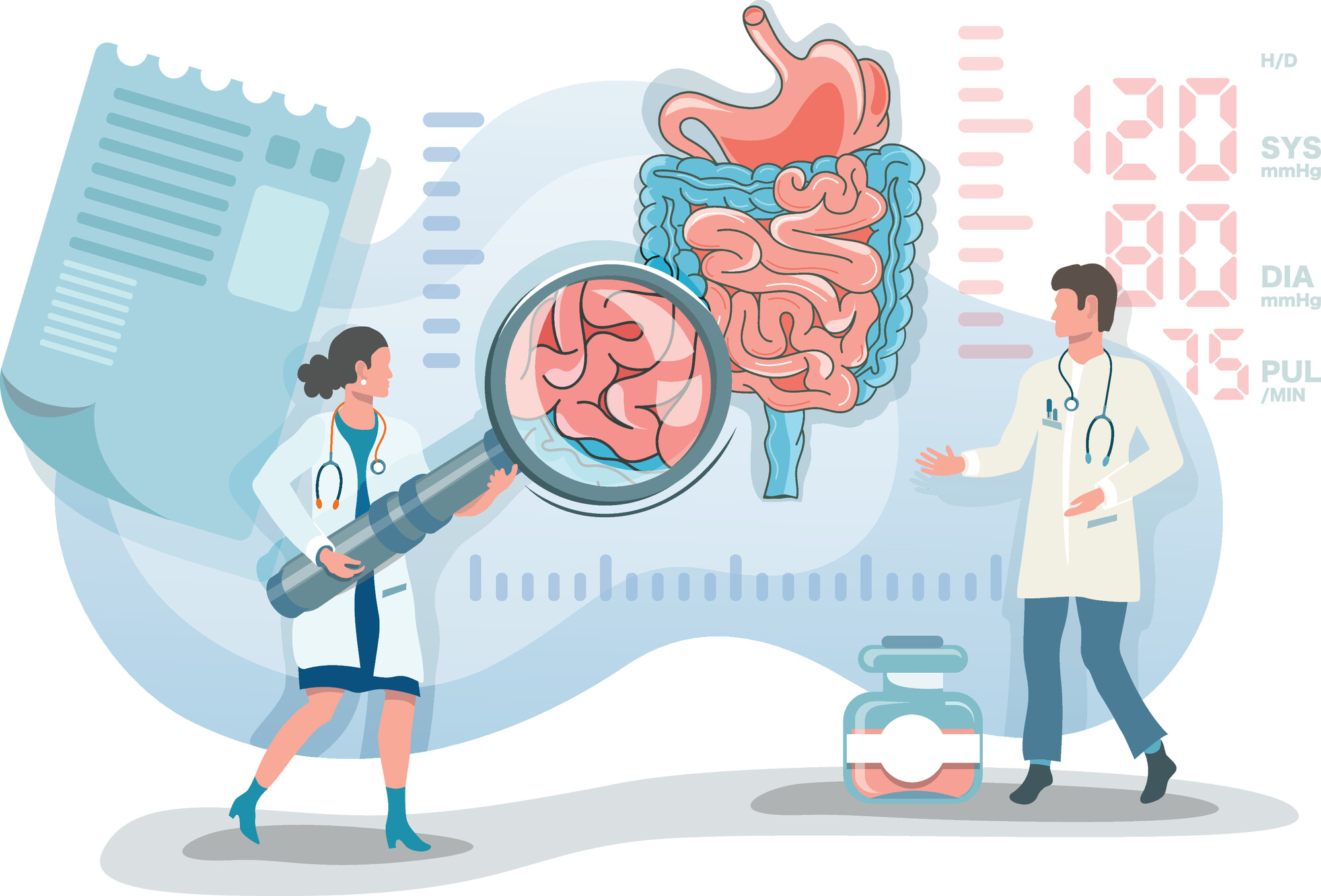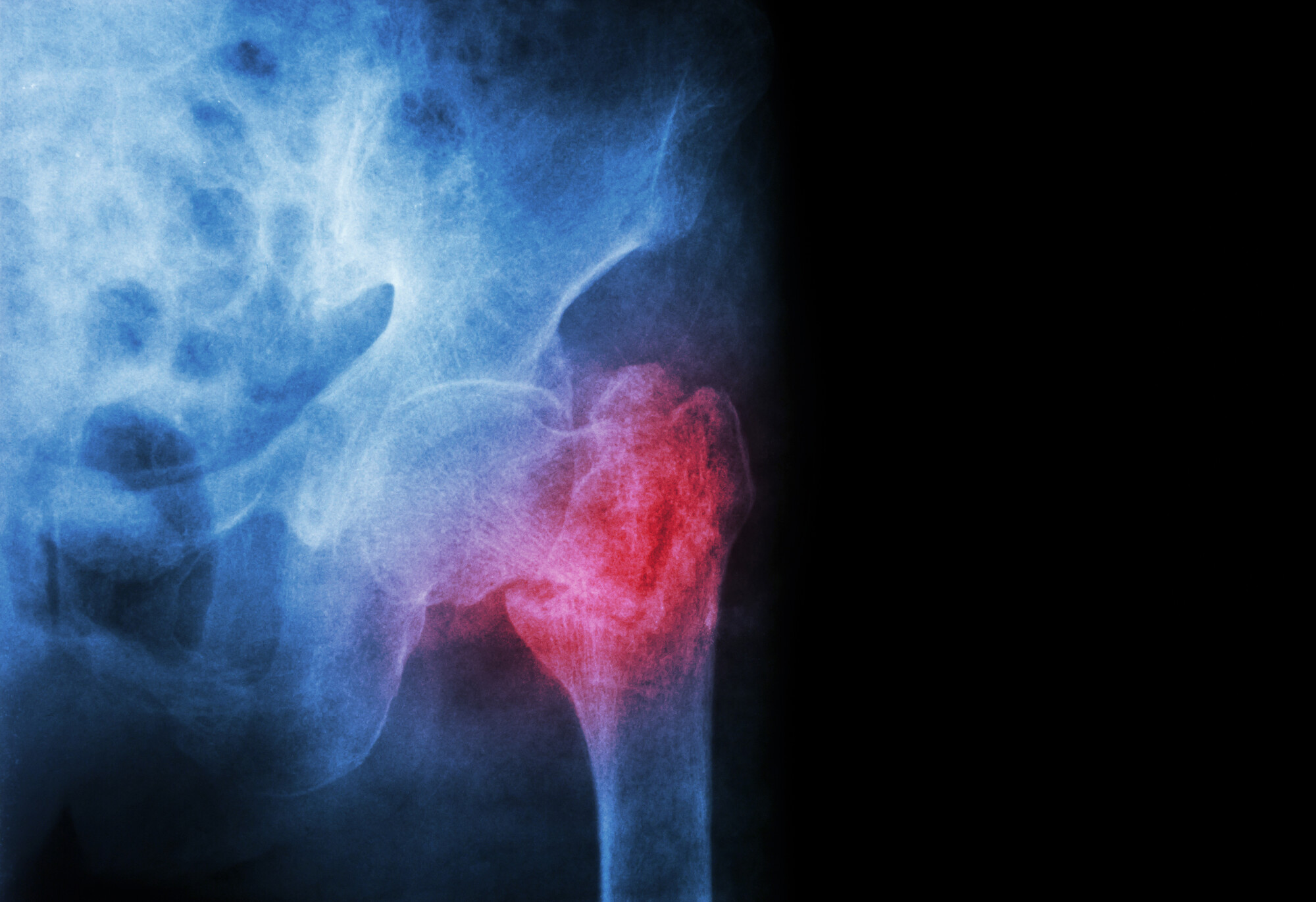Das sagt die Allgemeinärztin
von Dr. med. Sabine Gehrke-Beck, Fachärztin für Allgemeinmedizin in Berlin
Als Dauermedikation nimmt Herr W. seit circa drei Jahren Metformin (zweimal 500 mg) zur Behandlung seines Diabetes mellitus ein, außerdem seit circa fünf Jahren Valsartan und Amlodipin zur Senkung des Blutdrucks. Ich bespreche mit ihm, dass ein Husten aus unterschiedlichen Gründen länger anhalten kann und nicht unbedingt eine gefährliche Ursache dahinterstecken muss.
Auf jeden Fall sei es gut, dass er jetzt zur Abklärung gekommen ist. In der Anamnese fällt kein Warnzeichen (“Red Flag”) auf, das auf ein akut bedrohliches Problem hinweist. Er hat kein Gewicht verloren, auch Fieber, Luftnot oder Nachtschweiß fehlen.
Allerdings besteht durch das langjährige Rauchen einerseits ein erhöhtes Risiko für Lungenkrebs, andererseits könnte der Husten Anzeichen für eine noch unerkannte COPD sein.
Für die körperliche Untersuchung ist es wichtig, neben der Lungenauskultation auch eine Racheninspektion durchzuführen, um Hinweise auf eine chronische Sinusitis abzuklären. Zudem horche ich das Herz aufmerksam ab und achte dabei auf Anzeichen für eine Herzinsuffizienz, suche nach Lymphknotenschwellungen und prüfe, ob Knöchelödeme vorliegen. Optimalerweise hat das Praxispersonal in der Wartezeit bereits den Blutdruck kontrolliert.
Als wichtigste und erste diagnostische Untersuchung führe ich in der Praxis einen Lungenfunktionstest durch und überweise den Patienten in die Radiologie, um eine Computertomografie des Thorax vornehmen zu lassen. Die S3-Leitlinie der DEGAM aus dem Jahr 2021 sieht derzeit im Regelfall zunächst nur eine Röntgenuntersuchung der Lunge vor.
Im Fall von Herrn W. besteht jedoch durch seine Anamnese ein erhöhtes Risiko für ein Bronchialkarzinom, auch wenn keine weiteren Symptome vorliegen. Ich greife noch einmal positiv auf, dass Herr W. seinen Rauchkonsum beendet hat. Gleichzeitig erkläre ich ihm, dass beide Untersuchungen wichtig sind. Denn damit lasse sich klären, ob die Lunge durch den jahrelangen Konsum von Zigaretten geschädigt ist.
Anamnese und Untersuchung weisen weder auf einen gastroösophagealen Reflux hin noch auf eine Erkrankung der oberen Atemwege (etwa eine chronische Sinusitis), die den Husten auslösen könnte. Daher ist ein postinfektiöser Husten bei einer bronchialen Hyperreagibilität am wahrscheinlichsten.
Im nächsten Schritt bespreche ich mit Herrn W. deshalb, eine probatorische inhalative Kortisontherapie durchzuführen. Die Leitlinie empfiehlt explizit ein solches Vorgehen. Denn für die definitive Diagnose ist ein Methacholin-Provokationstest nötig – und selbst in der Großstadt müssen Patientinnen und Patienten in der Regel mehrere Monate auf einen Termin für diesen Test warten.
Eine probatorische Therapie kann dagegen oft schon in der ersten Woche die Symptome verbessern und spätestens nach zwei bis vier Wochen einen klaren Effekt zeigen.
Potenzielle Interessenkonflikte: Dr. Gehrke-Beck hat Vortragshonorare vom Medizinischen Fakultätentag und von der DEGAM erhalten.
Das sagt die Spezialistin
von Dr. med. Camilla Lüttecke-Hecht, Fachärztin für Innere Medizin und Pneumologie, Allergologie, Notfallmedizin, medikamentöse Tumortherapie, Lungenfacharztpraxis Mainz
Da der Husten bei Herrn W. seit mehr als acht Wochen besteht, handelt es sich per definitionem um einen chronischen Husten. Die sorgfältig erhobene Anamnese – vor allem im Hinblick auf einen Reflux wegen des vorliegenden nächtlichen Hustens sowie auf hustenfördernde Medikamente (zum Beispiel ACE-Hemmer) – sollte um die allergologische Anamnese ergänzt werden, da eine Hausstaubmilbenallergie durch ein allergisches Asthma ebenfalls zu nächtlichen Hustenepisoden führen kann.
Neben der Auskultation und der körperlichen Untersuchung ist die Spirometrie die schnellste und effizienteste Methode, eine Ventilationsstörung zu erkennen. Im vorliegenden Fall ist das Risiko für eine Obstruktion durch den früheren Nikotinkonsum erhöht.
Um diese von einem eventuell zusätzlichen oder ursächlichen Asthma abzugrenzen, sind weitere pneumologische Untersuchungen nötig. Dazu gehören der Methacholin-Provokationstest, die Messung des fraktionierten exhalierten Stickstoffmonoxids (FeNO), ein Allergietest sowie die Diffusionsprüfung.
Eine intensivere infektiologische Anamnese könnte gegebenenfalls Hinweise auf Erreger liefern, die längerfristigen Husten fördern. Hier wäre zum Beispiel zu klären, ob typische Symptome für einen Keuchhusten vorliegen oder ob es im Umfeld des Patienten erkrankte Personen gibt, bei denen ein Erreger (vor allem Mykoplasma oder SARS-CoV-2) nachgewiesen wurde.
Bei der Spirometrie ist es wichtig, auch auf eine mögliche Restriktion zu achten. Denn bei Infekten können Pleuraergüsse oder eine Zwerchfelldysfunktion (-parese) auftreten, die mitunter Husten, vor allem nachts, verursachen.
Die S3-Leitlinie sieht als bildgebende Diagnostik eine Röntgenuntersuchung des Thorax vor. Diese reicht zunächst aus, um wesentliche Auffälligkeiten festzustellen. Durch den starken Nikotinkonsum in der Vergangenheit ist das Risiko für ein Lungenkarzinom aber erhöht, sodass man dem Patienten trotzdem eine Computertomografie (CT) des Thoraxbereichs als Untersuchung anbieten kann.
Die CT kann relevante Befunde sicher bestätigen oder ausschließen, da besonders kleine Läsionen bzw. Rundherde sowie diskrete Infiltrate oder interstitielle Veränderungen im Röntgenbild oft nicht sichtbar sind.
Obwohl der Patient im vorliegenden Fall bereits zehn Wochen Beschwerden hat, würde ich zunächst an einen prolongierten postinfektiösen Reizhusten denken. Als Therapie würde auch ich ein inhalatives Steroid vorschlagen (ggf. in Verbindung mit einem langwirksamen Beta-Agonisten, falls eine Obstruktion vorliegt).
Dabei ist zu beachten, dass die Verdachtsdiagnose hyperreagibles Bronchialsystem (J98.8 V) oder Asthma (J45.9(9) V) in einigen KV-Bereichen nicht die In-Label-Verordnung eines inhalativen Kortikosteroids rechtfertigt. Dies ist im Hinblick auf die zunehmenden Einzelprüfungen relevant. Eine Möglichkeit ist es, das Arzneimittel dann privat zu rezeptieren.
Potenzielle Interessenkonflikte: Dr. Lüttecke-Hecht hat Vortragshonorare erhalten von AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Novartis, UCB, GSK, Teva und Berlin-Chemie.
Das sagt die evidenzbasierte Medizin
Die S3-Leitlinie “Akuter und chronischer Husten” definiert das Symptom Husten als chronischen Husten, wenn es über acht Wochen anhält. Ebenso wie beim akuten Husten ist ein systematisches Vorgehen angezeigt. Eine gezielte, ausführliche Anamnese sowie eine gründliche körperliche Untersuchung führen dabei in den meisten Fällen zu einer schnellen Diagnose.
Für die Anamnese ist auf jeden Fall wichtig, den Tabakkonsum inklusive E-Zigaretten bzw. Vernebler aktuell und in der Vergangenheit zu erfragen, da dieser das Risiko für ein Bronchialkarzinom oder eine chronisch (obstruktive) Bronchitis erhöht.
Dabei werden insbesondere rauchende Patienten über 45 Jahre mit neu aufgetretenem Husten und Patienten über 55 mit mehr als 30 pack-years als risikobehaftet bewertet. Für die letztgenannte Gruppe gilt dies auch, wenn innerhalb der letzten 15 Jahre das Rauchen beendet wurde.
Auch nach Cannabiskonsum sollte man fragen. Cannabisraucher leiden häufiger unter Husten, Luftnot, Giemen und Thoraxschmerzen. Wird der Konsum beendet, nehmen die Beschwerden aber wieder ab.
Zur Anamnese gehört die Abklärung folgender Punkte:
- Dauer und Charakter des Hustens (Trigger, Auswurf, Hämoptysen)
- weitere Symptome (Fieber, Gewichtsverlust, Heiserkeit, Sodbennen, Schmerzen, Dyspnoe etc.)
- Exposition (Rauchen von Nikotin oder Cannabis, arbeitsplatzbezogene Noxen, Tierkontakte, Reiseanamnese)
- Vorerkrankungen (zum Beispiel vorausgegangene Infekte, Herzerkrankungen, Allergien, Asthma, COPD etc.)
- Medikamente (etwa ACE-Hemmer)
Kann eine bedrohliche Erkrankung als Ursache des Hustens (“Red Flags”, s. Tabelle unten) ausgeschlossen werden und ist die Medikamentenanamnese unauffällig, empfiehlt die Leitlinie nach der körperlichen Untersuchung ein Röntgen des Thorax in zwei Ebenen und eine Lungenfunktionsdiagnostik sowie ggf. einen Provokationstest und einen Allergietest.