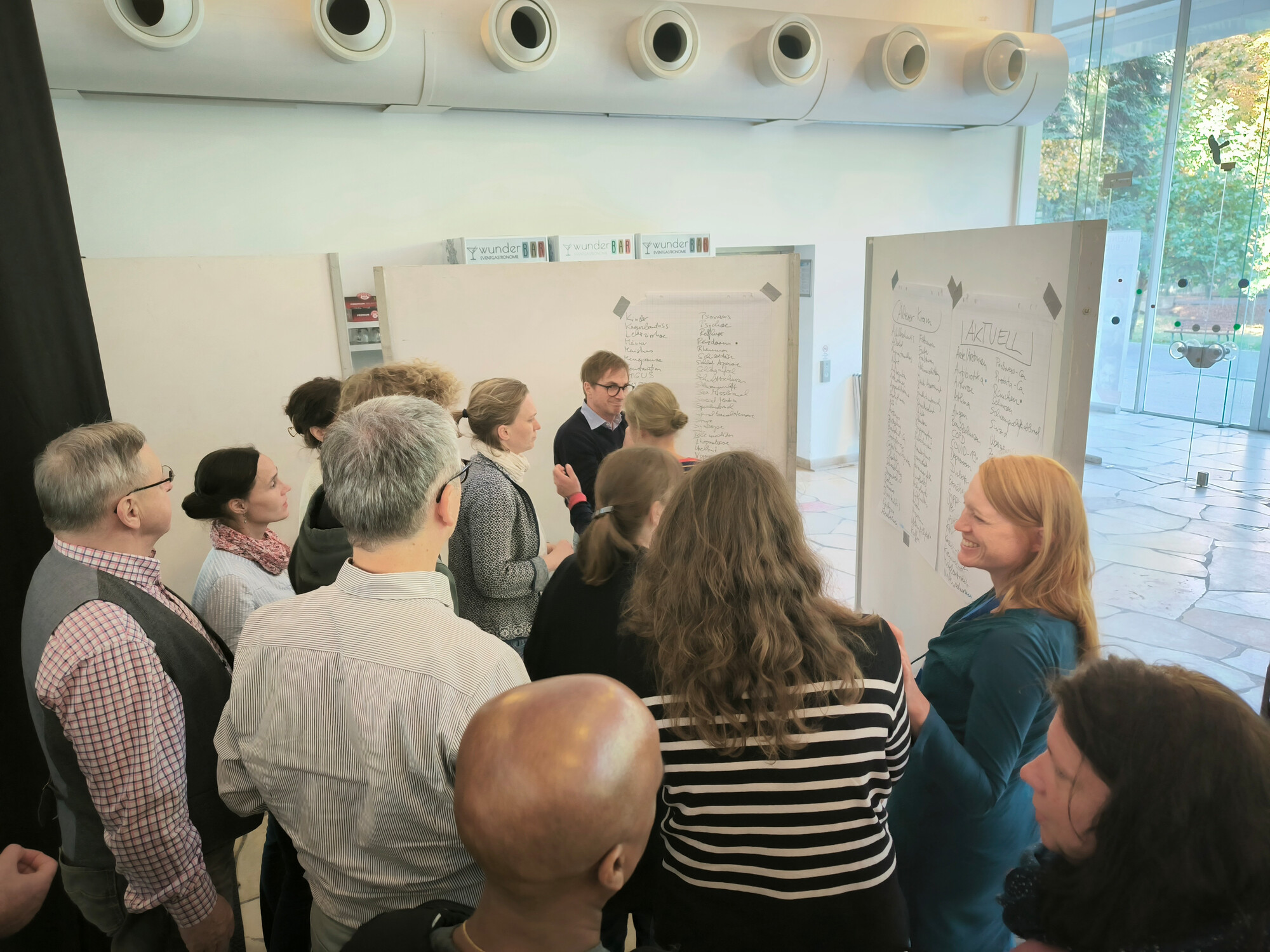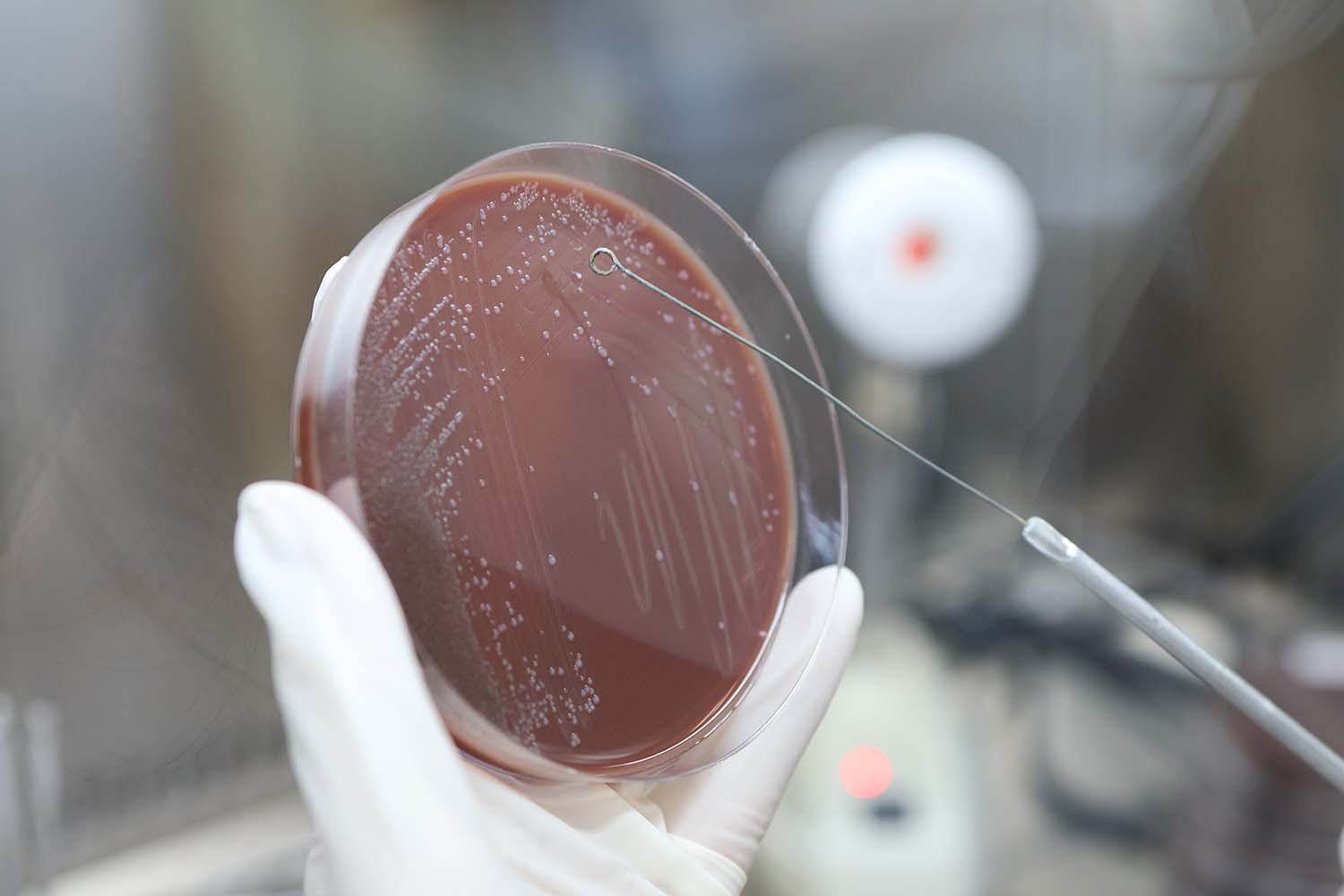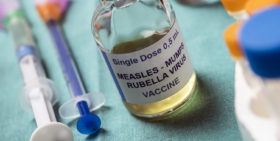Antibiotika: Praxistipp Standby-Rezept
Der Patient mit Atemwegsinfekt drängt auf ein Antibiotikum, Hausärztin oder Hausarzt sind davon aber nicht überzeugt: Bei diesem beschriebenen Szenario nicken alle Teilnehmer wissend. Doch wie reagieren?
Ein sogenanntes Standby-Rezept (“delayed prescription”) kann in diesem Fall helfen, Klinikaufnahmen und Todesfälle zu reduzieren und sogar die Bindung zwischen Arzt und Patient zu stärken. Darauf weist ein Review von neun randomisierten Studien mit 55.682 Menschen mit Atemwegsinfekten hin.
Das Ergebnis: Die Symptomdauer lag mit 11,4 versus 10,9 Tagen zwar geringfügig länger bei einer verzögerten versus sofortiger Verschreibung, dagegen gab es weniger schwere Verläufe und vor allem zeigten sich Patientinnen und Patienten zufriedener nach der gemeinsamen Entscheidungsfindung. Mit Blick auf die berichtete Symptomstärke zeigten sich keine Unterschiede.
Kollegentipp: Auch ein Verweis auf unerwünschte Nebenwirkungen – etwa Darmflora oder mögliche Pilzinfektionen – könne helfen, “Antibiotika-Forderungen” zu entkräften, berichteten Hausärztinnen und Hausärzte im Seminar. doi.org/10.1136/bmj.n808
Rauchstopp: Viele Wege führen ans Ziel
Sowohl E-Zigarette als auch Vareniclin können helfen, mit dem Rauchen aufzuhören. Darauf weist eine kleine randomisierte Studie aus Finnland hin. Hierin erhielten 458 Menschen zwischen 25 und 75, die einen Rauchstopp anstrebten, E-Zigaretten oder Vareniclin jeweils gegen Placebo.
Den Endpunkt “7 Tage ohne Rauchen” hatten nach 26 Wochen jeweils rund 40 Prozent mit E-Zigaretten oder Vareniclin geschafft (Differenz zwischen beiden Methoden statistisch nicht signifikant), unter reinem Placebo nur knapp 20 Prozent. doi.org/10.1001/jamainternmed.2024.1822
Koronarer Stent: Keine Belastungstests nötig
Es gibt kein medizinisches Argument, bei beschwerdefreien Personen nach einem Stent routinemäßig Belastungsuntersuchungen wie eine Ergometrie durchzuführen. Darauf weist eine randomisierte Studie aus Südkorea hin.
Bei 1.706 Patienten, darunter 660 mit Diabetes, wurden dafür Routine-Belastungstests mit “usual care” verglichen mit Blick auf einen Sammelendpunkt nach zwei Jahren (Tod, Infarkt oder instabile Angina pectoris). Dabei zeigte sich kein signifikanter Unterschied: 7,1 versus 7,5 Prozent bei Personen mit Diabetes (p = 0,82) und 4,6 versus 5,1 Prozent bei Personen ohne Diabetes (p = 0,68).
Kollegentipp: Günter Egidi plädiert dafür, hier “standhaft” zu bleiben und – auch bei möglichen Patientennachfragen – keine Routine-Belastungstests anzuordnen, um Ressourcen im System für echte Beschwerden freizuhalten. doi.org/10.1056/nejmoa2208335
Schnupfenzeit: Geheimtipp Kochsalz-Nasenspray
Die rasche Nutzung von Kochsalz-Nasenspray bei leichten grippalen Infekten kann Personen mit Risikofaktoren – etwa Asthma oder Diabetes – helfen, Krankheitstage und Antibiotika-Gebrauch zu reduzieren.
Zu diesem Schluss kommt eine randomisierte Studie mit 13.799 Patientinnen und Patienten in 332 britischen Hausarztpraxen. In sechs Monaten wurden unter Kochsalz-Nasenspray 11,8 Krankheitstage berichtet, bei Gabe eines Nasensprays auf Gel-Basis 12,0 Tage, unter “usual care” waren es 15,1.
Der Antibiotika-Gebrauch lag 31 Prozent niedriger (Gel-Spray: minus 35 Prozent). Tipps zu Stressreduktion und Bewegung hatten keinen Einfluss auf die Krankheitstage, wohl aber auf den Antibiotika-Gebrauch (minus 26 Prozent). doi.org/10.1016/s2213-2600(24)00140-1
Antidepressiva: An Entzugssymptome denken
Man muss mit ca. 15 Prozent echten Entzugssymptomen nach Absetzen von Antidepressiva rechnen, vor allem nach Venlafaxin, Imipramin und Escitalopram. Zu diesem Ergebnis kommt ein Review von insgesamt 79 Studien (n = 21.002, 72 Prozent Frauen, Altersdurchschnitt 45 Jahre).
Bei 16.532 Patientinnen und Patienten wurde dabei ein Antidepressivum abrupt abgesetzt, 4.470 erhielten Placebo. Entzugssymptome wurden daraufhin für 31 versus 17 Prozent berichtet. Schwere Entzugssymptome kamen bei 2,8 versus 0,6 Prozent der Personen vor, vor allem nach Paroxetin, Imipramin und Venlafaxin.
Kollegentipp: Ein Ausschleichen der Antidepressiva ist vor diesem Hintergrund umso wichtiger. Tropfen helfen, “stufenlos” herunterzudosieren. doi.org/10.1016/S2215-0366(24)00133-0
Schmerzmittel: Vorsicht bei jungen Frauen
Die gleichzeitige Einnahme von NSAR und Pille erhöht das Thrombose-Risiko deutlich, vor allem unter Desorgestrel und Drospirenon. Das zeigt eine populationsbasierte Kohortenstudie aus Dänemark, die alle 15- bis 49-jährigen Frauen des Landes ohne Thrombose- oder Krebs-Anamnese zwischen 1996 und 2007 untersucht hat (n = 2.029.065).
Dabei fanden sich 8.710 thromboembolische Ereignisse. Das Ergebnis: Das Thrombose-Risiko bei NSAR-Einnahme war für Frauen, die keine Pille nahmen, 7,2-fach erhöht (CI 6,0-8,5), bei “Risiko-Pillen” 11-fach (CI 9,6-12,6), bei “Niedrig-Risiko-Pillen” 4,5-fach erhöht (CI 2,6-8,1).
Auf 100.000 Frauen kamen nach einer Woche mit NSAR vier Thrombosen bei Frauen ohne Pille, 23 bei “Risiko”- und drei bei “Niedrig-Risiko-Pille”. doi.org/10.1136/bmj-2022-074450
Schwangerschaftsabbruch in der Hausarztpraxis
Während es 2003 in Deutschland noch 2.050 Kliniken und Praxen gab, die Schwangerschaftsabbrüche durchführten, waren es 2022 noch 1.105. “Die Zahl hat sich also in 20 Jahren halbiert, wobei die Zahl der Abbrüche mit rund 100.000 pro Jahr seit zehn Jahren relativ konstant ist”, berichtete Dr. Margit Kollmer.
Sie selbst führt medikamentöse Schwangerschaftsabbrüche in ihrer Hausarztpraxis durch – und möchte auch andere Praxen dafür gewinnen. Der Akt selbst sei nicht komplex, komplex seien die gesetzlichen Regelungen.
So gelten in jedem Bundesland spezifische Vorgaben, ob und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen Hausärztinnen und Hausärzte überhaupt einen Abbruch durchführen dürfen (eine von “Hausärztliche Praxis” erstellte Übersicht finden Sie unter www.hausarzt.link/PWzBm).
Ist es nach den Länderregelungen prinzipiell möglich, einen Abbruch durchzuführen, muss vorab Formelles erledigt werden – Kollmer selbst hat dafür etwa einen Monat Vorlaufzeit benötigt:
- Meldung an die jeweils zuständige Landesbehörde, dass Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden
- Berufshaftpflicht informieren
- Der Bezug der Medikamente erfolgt nach §47 Arzneimittelgesetz über einen Sondervertriebsweg direkt vom Hersteller (Anmeldung erforderlich)
- Meldepflicht an das statistische Bundesamt (Anmeldung erforderlich)
- Für eine Kostenübernahme durch die Krankenkasse (neben medizinischer/kriminologischer Indikation bei “sozialer Bedürftigkeit”) wird ein Institutskennzeichen benötigt. Dieses kann bei der ARGE-IK beantragt werden.
Auch rechtliche Voraussetzungen müssen beachtet werden, etwa die Vorlage eines Beratungsscheins, der mindestens drei Tage zuvor ausgestellt sein muss (mehr dazu in der DEGAM-Praxisempfehlung).
Kollmer: “Aus medizinischer Sicht kann man sich an die S2k-Leitlinie ‚Schwangerschaftsabbruch im ersten Trimenon‘ (www.hausarzt.link/ywUr2) und die DEGAM-Praxisempfehlung zur S2k-Leitlinie (www.hausarzt.link/JW9nv) halten.”
Hypothyreose: Es gibt keine “typischen” Symptome!
“Bei einer Hypothyreose gibt es keine ‚typischen‘ Symptome wie Haarverlust, Müdigkeit oder Gewichtsveränderungen!” erklärte Dr. Til Uebel. Das betont auch die S2k-Leitlinie “Erhöhter TSH-Wert in der Hausarztpraxis” (www.hausarzt.link/mZTmo) und empfiehlt daher auch keine gezielte Abfrage dieser Symptome.
Zudem sollte bei asymptomatischen Personen kein routinemäßiges TSH-Screening durchgeführt werden. “Das gilt auch bei Frauen mit Kinderwunsch oder bei Schwangeren ohne bekannte Schilddrüsenerkrankung”, erklärte Uebel, der Mitautor der S2k-Leitlinie ist.
Der Erstbefund “erhöhter TSH-Wert” werde oft zufällig gestellt und sollte bei unauffälliger Anamnese wiederholt werden. “Besonders TSH-Werte aus der Klinik sollten nach vier Wochen kontrolliert werden!” Als alterstypische Referenzwerte gab Uebel an:
- 18 bis 70 Jahre: < 4,0 mU/l; gilt auch für Schwangere
- >70 bis 80 Jahre: < 5,0 mU/l
- >80 Jahre: < 6,0 mU/l
Ist auch bei erneuter Messung der TSH-Wert erhöht, sollte laut Leitlinie der fT4-Wert bestimmt werden.
- Liegt der TSH-Wert über dem altersspezifischen Referenzwert (s.o.) und der fT4-Wert im Normbereich (laut Leitlinie 10,1 ± 1,2 bis 22,1 ± 2,3 pmol/l, je nach Testverfahren), wird die Diagnose latente Hypothyreose gestellt. Über eine Hormonsubstitution werde dann individuell entschieden, wobei bei einem TSH-Wert ≤ 10 ohne Symptome keine Substitution erfolgen sollte, so Uebel.
- Liegt der TSH-Wert über dem altersspezifischen Referenzwert und der fT4-Wert unterhalb des Normbereichs wird die Diagnose manifeste Hypothyreose gestellt, bei der eine Hormonsubstitution indiziert ist.
Statistik ist kein Hexenwerk
Was bedeutet das eigentlich, ein auffälliger Befund – beim PSA-Test oder beim Hautkrebs-Screening? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, tatsächlich erkrankt zu sein?
“Bei der Antwort hilft die Bayes’sche Statistik – und die ist gar nicht so schwer zu verstehen”, meinte Dr. Raphael Kunisch und veranschaulichte dies am Beispiel des Hautkrebs-Screenings:
“Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten in einer Hausarztpraxis und bieten visuelles Haut-Screening zur Früherkennung von Hautkrebs an. Sie beraten eine symptomfreie Frau, die einen auffälligen Befund im Screening-Test erhalten hat. Die Patientin möchte wissen, was dies nun für sie bedeutet.”
Folgende Informationen sind bekannt:
- 5 von 10.000 Frauen haben Hautkrebs ohne es zu wissen.
- 30 von 50 Frauen, die Hautkrebs haben, erhalten ein positives Ergebnis im Screening, werden also vom Test erkannt. Die Sensitivität des Screenings liegt also bei 30/50 = 0,6 = 60 Prozent.
- 1.999 von 10.000 Frauen haben keinen Hautkrebs und erhalten fälschlicherweise dennoch einen positiven Befund (~20 Prozent). Die Spezifität des Tests liegt also bei ~80 Prozent (8.000/10.000 haben keinen Hautkrebs und erhalten ein richtig-negatives Ergebnis).