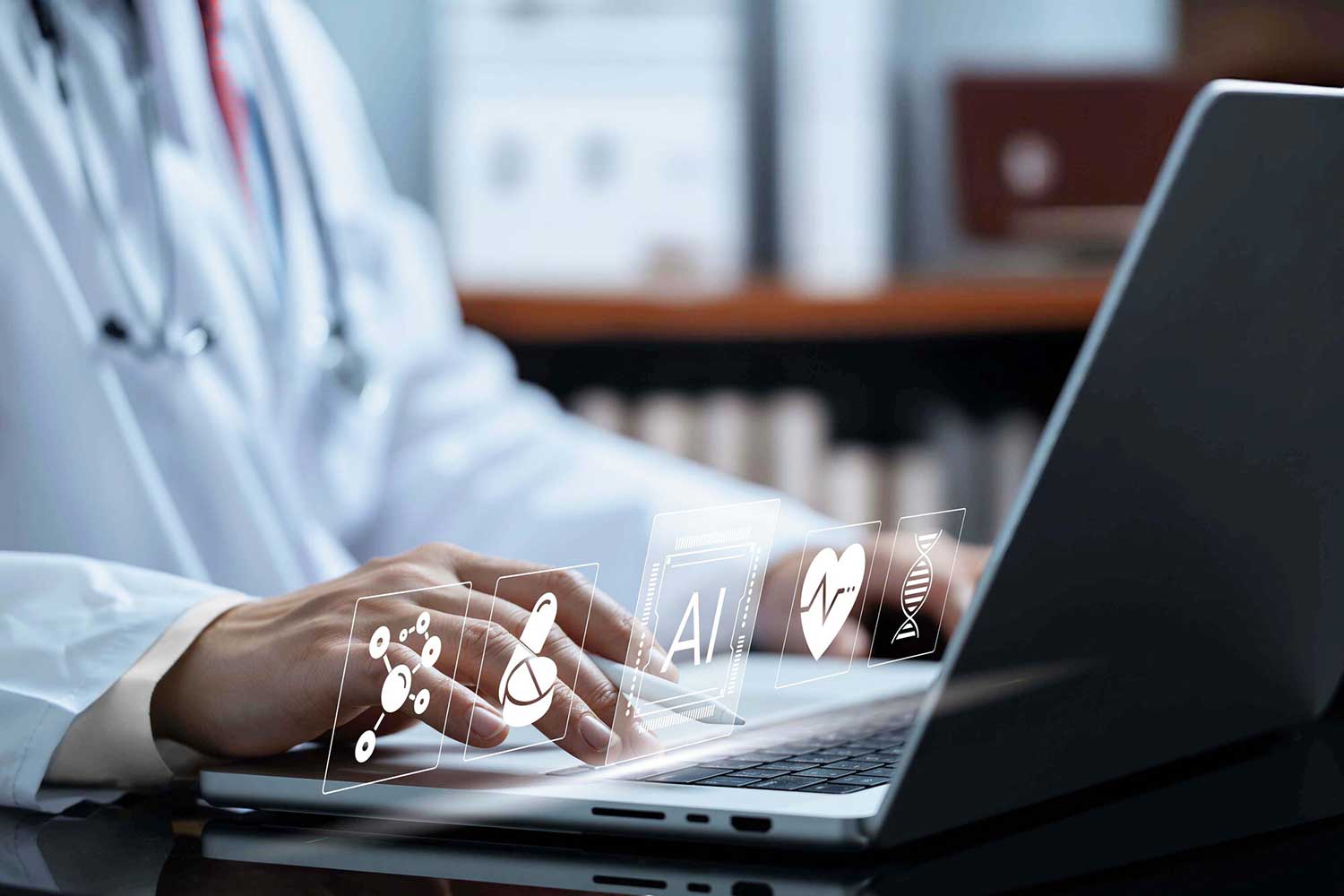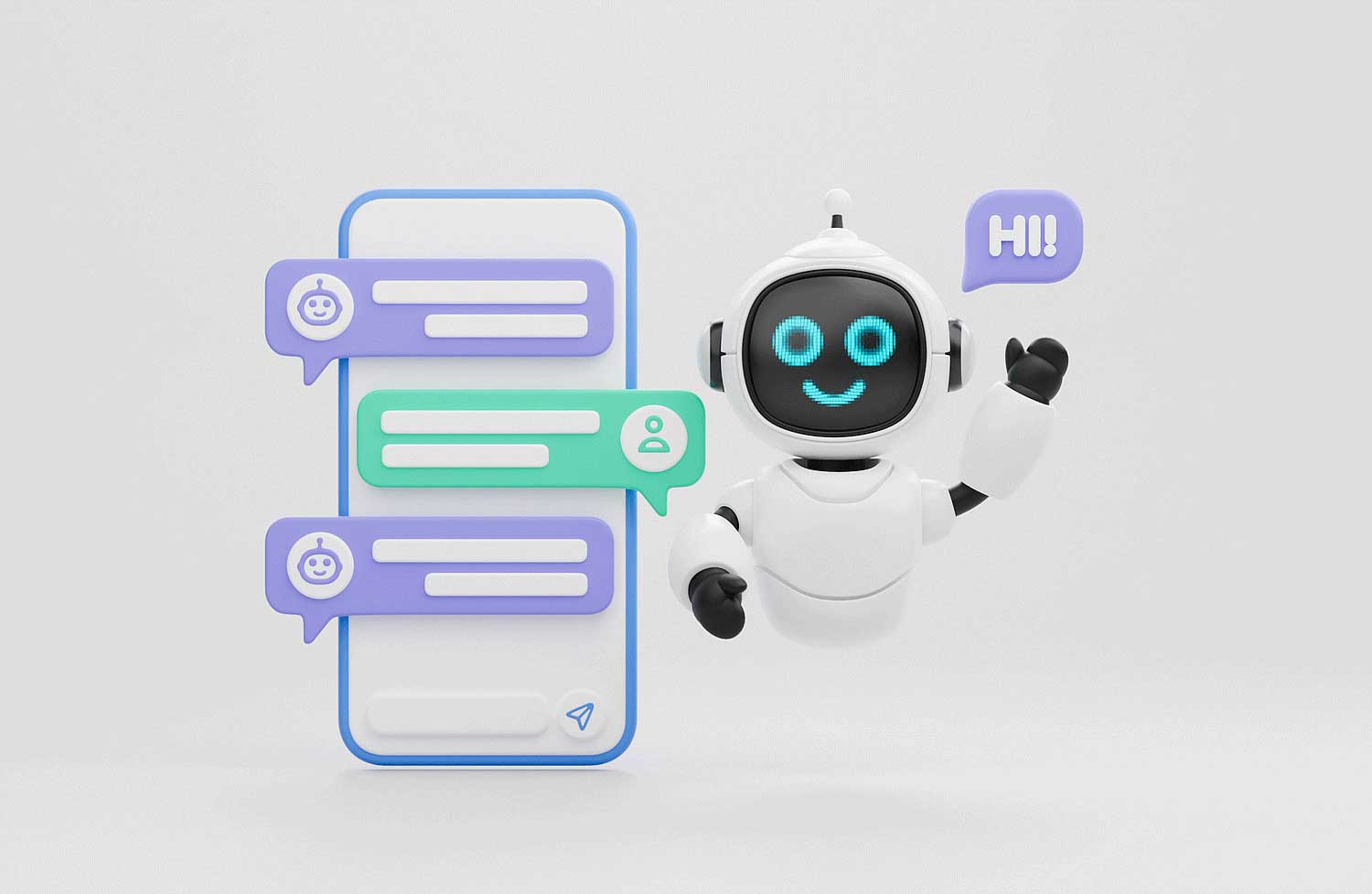Montagmorgen kann ganz schön hektisch sein. Ärztinnen und Ärzte wissen, wie schnell der Wochenbeginn zum Zeitkiller wird: Menschen mit Infekten, die eine Krankschreibung wollen, Altenheime, die um Unterschriften und Rezepte bitten, und das Telefon, das dauerklingelt.
Fehlt dann noch eine Medizinische Fachangestellte (MFA) wegen Krankheit, reichen Kapazitäten oft nicht aus, um die stetig steigende Zahl Hilfesuchender zu bewältigen.
Dr. Martin Deile will neue Wege gehen, Ressourcen schaffen und vorhandene schonen. Mit Hilfe von KI-Technologie modernisiert er seine Praxis. Seine Erfahrungen sind ein Beispiel, wie Künstliche Intelligenz (KI) im Alltag unterstützen kann.
Der Allgemeinmediziner setzt auf Programme wie Docyet, das als Medizinprodukt zugelassen ist, sowie die Praxissoftware Tomedo und den Symptomchecker, den er und auch die AOK seit mehreren Jahren einsetzen.
Docyet ist ein KI-Assistent, der Patientenanfragen in Echtzeit analysiert und darauf leitlinienorientierte Informationen liefert. Handelt es sich nur um eine Erkältung oder bereits um eine Angina? Der webbasierte Bot führt Patientinnen und Patienten durch bis zu 20 symptombasierte Fragen und erkundigt sich auch nach Vorerkrankungen.
Die Anfragenden geben ihre Symptome an und erhalten eine erste Einschätzung. Und das alles, bevor ein Termin vereinbart wird. Reine Atemwegsinfekte werden erkannt und die nötige Krankmeldung, soweit möglich, vorbereitet.
Der Weg in die Praxis oder das Warten am Praxistelefon können in einigen Fällen entfallen. “Mehr als 75 Prozent meiner Patienten nutzen unsere digitalen Kanäle”, erzählt Deile.
Mehr Zeit fürs Gespräch
Anfragen, die bisher persönlich oder telefonisch geklärt werden mussten, übernimmt in Deiles Praxis zuerst Docyet. Das spart ihm zufolge Zeit und ermöglicht es, sich auf komplexere Anfragen zu konzentrieren. Sprechstundentermine werden weniger, das Telefon klingelt seltener.
Durch die freie Kapazität kann der Arzt neue Menschen aufnehmen, die seine persönliche Zuwendung brauchen, und mehr Zeit fürs Gespräch aufbringen.
Die Apps ermöglichen zudem eine kontinuierliche Betreuung auch außerhalb der Sprechzeiten. Das erleichtert die Versorgung von Menschen, die regelmäßig Fragen oder Anliegen haben, ohne jedes Mal einen Termin vereinbaren zu müssen, erzählt Deile. So bleibe er sogar vom Sofa aus mit seinen Patientinnen und Patienten in Kontakt – oft bis weit nach Feierabend.
Ob Kolleginnen und Kollegen dies anbieten möchten, ist natürlich eine hoch individuelle Entscheidung. In Deiles Wahrnehmung jedoch überwiegt der Nutzen – gerade bei der Betreuung chronisch kranker Menschen – den zusätzlichen Stress.
Docyet und andere Programme helfen Deile auch, Verwaltungsaufgaben zu automatisieren. Das bedeutet weniger Papierkram und mehr Zeit für die zwischenmenschliche Arbeit. Mit der digitalen Dokumentation und den Vorschlägen der App hat das Dresdner Team zum Beispiel schneller Zugriff auf Patientendaten und gewinnt Zeit, weil Suchen wegfallen.
“Empowerment” für Patienten
Menschen werden durch die KI angeleitet, sich selbst mehr über ihre Symptome und Behandlungswege zu informieren. Deile betont, dass informierte Erkrankte oft schneller Fortschritte machen und weniger Rückfragen haben.
“Für viele sind die Apps ein Empowerment, sie können aktiv werden, wenn sie Unterstützung in Gesundheitsfragen brauchen und quälen sich nicht durch endlose Warteschleifen am Telefon”, weiß Deile.
Auch das entlaste. Liegt ein Patient etwa krank im Bett, kann er über Messenger Kontakt mit der Praxis aufnehmen. Über einen Link wird er dann zum Anamnese-Bot Docyet weitergeleitet. Dieser gibt eine Ersteinschätzung, ob es sich um einen harmlosen Infekt handelt oder ob ein Arztbesuch nötig ist.
Da die KI von Docyet dazulernt, verbessere sich die Qualität der Vorschläge kontinuierlich. Gerade bei chronischen Erkrankungen, die regelmäßige Kontrollen und Anpassungen erfordern, sieht Deile einen Vorteil.
In einem Selbstversuch gab er seine Kniebeschwerden an. Nach einigen Wochen kontrollierte sich die App selbst und fragte bei ihm nach, ob das Knie behandelt wurde und wie sich die Beschwerden entwickelt haben.
Bei Atemwegsinfekten etwa liege die Zuverlässigkeit der digitalen Unterstützung bei fast 100 Prozent, beobachtet der Hausarzt beim Einsatz in seiner Praxis.
Fazit: Ergänzung, kein Ersatz
Langfristig sieht Deile die Chance, durch KI den steigenden Ärztebedarf abzufedern und die medizinische Versorgung vor allem im ländlichen Raum aufrecht zu erhalten. Allein in Sachsen sind rund 25 Prozent der Hausarztsitze frei, erinnert er.
Zudem ist der Mediziner überzeugt, dass die Zukunft der Patientenversorgung in der Kombination von persönlicher Expertise und technischen Hilfsmitteln liegt. “KI-Tools werden die ärztliche Kompetenz nicht ersetzen, sondern ergänzen”, meint er.