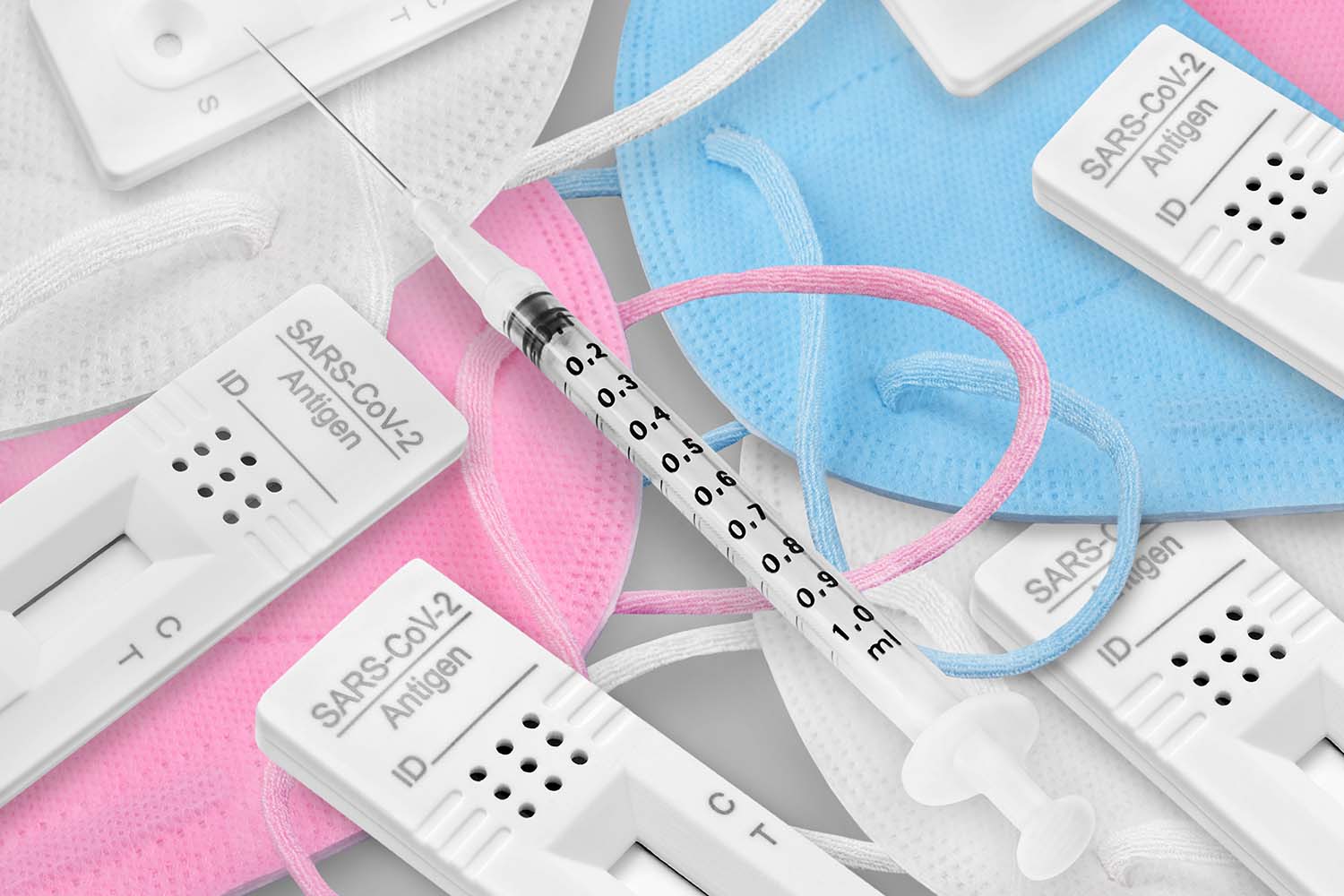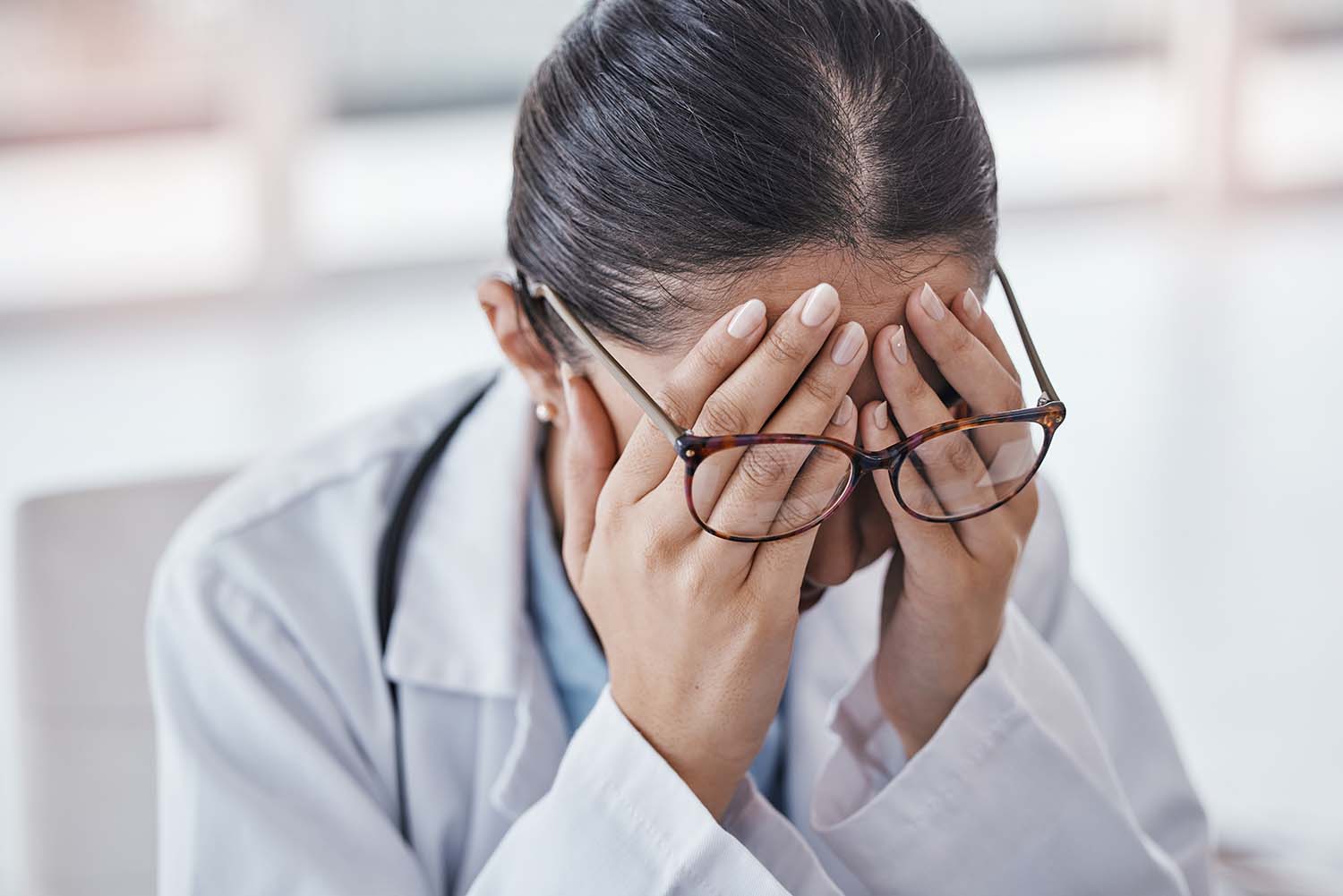Berlin. Überversorgung ist auch in hausärztlichen Praxen zu finden. Das geht aus einer am Montag (3. März) vorgelegten Studie von Technischer Universität (TU) Berlin, Techniker Krankenkasse (TK) und Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) hervor. Insgesamt wurden hierbei 24 Leistungen identifiziert, die medizinisch „in Frage gestellt“ werden können, die aber gleichwohl relativ häufig erbracht und abgerechnet werden. Hierzu gehört etwa die Messung der Schilddrüsenhormone fT3/fT4 bei Personen mit bekannter Schilddrüsenunterfunktion.
Das von TU, TK und Zi betreute Forschungsprojekts „IndiQ – Entwicklung eines Tools zur Messung von Indikationsqualität in Routinedaten und Identifikation von Handlungsbedarfen und -strategien“ basiert auf TK-Abrechnungsdaten. Die Studie mit einer Laufzeit von vier Jahren (Mai 2020 – April 2024) ist vom Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses mit rund 800.000 Euro gefördert worden.
Bis zu 10 Prozent der Leistungen “fragwürdig”
Die Auswertung von TK-Abrechnungsdaten hat ergeben, dass von 10,6 Millionen untersuchten Leistungen pro Jahr durchschnittlich zwischen 430.000 (4 Prozent) und 1,1 Millionen Fälle (10,4 Prozent) als Leistungen mit geringem medizinischem Wert eingestuft werden können.
Beispiel aus der Praxis: Bei 214.347 Patientinnen und Patienten mit diagnostizierter Schilddrüsenunterfunktion wurden 315.622-mal „unangemessene Laborkontrollen“ auf fT3/fT4 veranlasst worden. Der TSH-Wert gilt in der Regel bereits als aussagekräftiger Indikator. Die S2k-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin (DEGAM) nennt nur eine Empfehlung für eine spezifische Indikation: Unter Amiodaron-Dauertherapie ist demnach ein halbjährliches Monitoring von TSH, fT3 und fT4 empfohlen, in der Regel liefert die zusätzliche Messung von fT3/fT4 sonst aber keine weiteren diagnostischen Erkenntnisse. Bei der Erstdiagnose rät die DEGAM zur einmaligen Messung von fT4, um den Verdacht auf Hypothyreose zu bestätigen.
In der Zi-Auswertung führt die fT3/fT4-Bestimmung die Liste der unnötigen Testungen an, gefolgt von der Bestimmung von Tumormarkern ohne bestehende Krebsdiagnose, die zur Verlaufskontrolle bei bestehenden Krebserkrankungen und nicht zur allgemeinen Diagnostik dienen (63.940 Fälle bei 55.816 Patientinnen und Patienten). Sie werden in der Regel als Individuelle Gesundheitsleistung (IGeL) abgerechnet.
Antibiotika führen Arzneiverordnungen an
Platz 1 unter den unnötigen Arzneiverordnungen belegen Antibiotika bei Atemwegserkrankungen, gefolgt von Benzodiazepinen bei älteren Menschen sowie Antibiotika bei Mittelohrentzündungen.
Gerade vor dem Hintergrund deutlich knapper werdender finanzieller und personeller Ressourcen sei die Studie von Bedeutung, heißt es in einer begleitenden Mitteilung. Die direkten Kosten für alle 24 identifizierten Leistungen belaufen sich im ambulanten Sektor der TK auf etwa zehn bis 15,5 Millionen Euro jährlich. Bei Kosten für einen fT3- oder fT4-Test von rund 3,70 Euro ließen sich allein hier über 2,15 Millionen Euro vermeiden.
Zur Einordnung: Im Jahr 2023 hat die TK gut sieben Milliarden Euro für ärztliche Behandlungen ausgegeben.