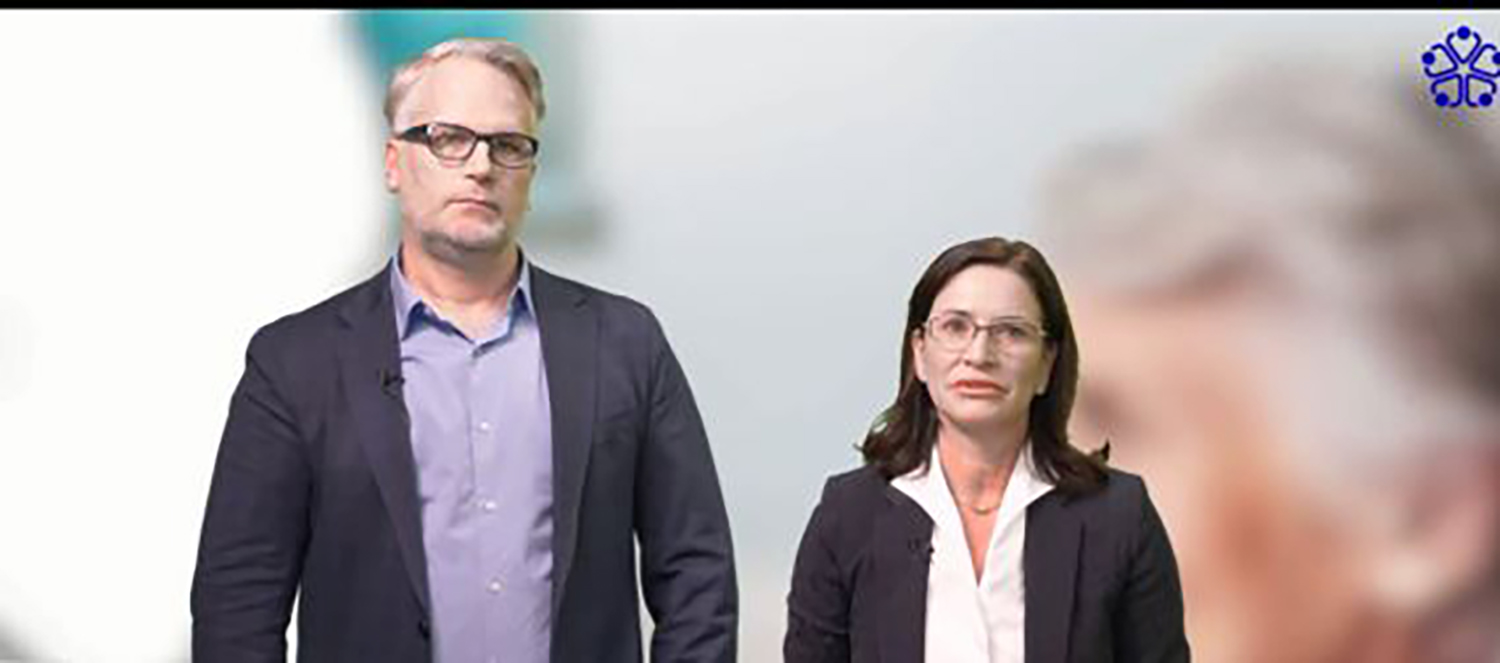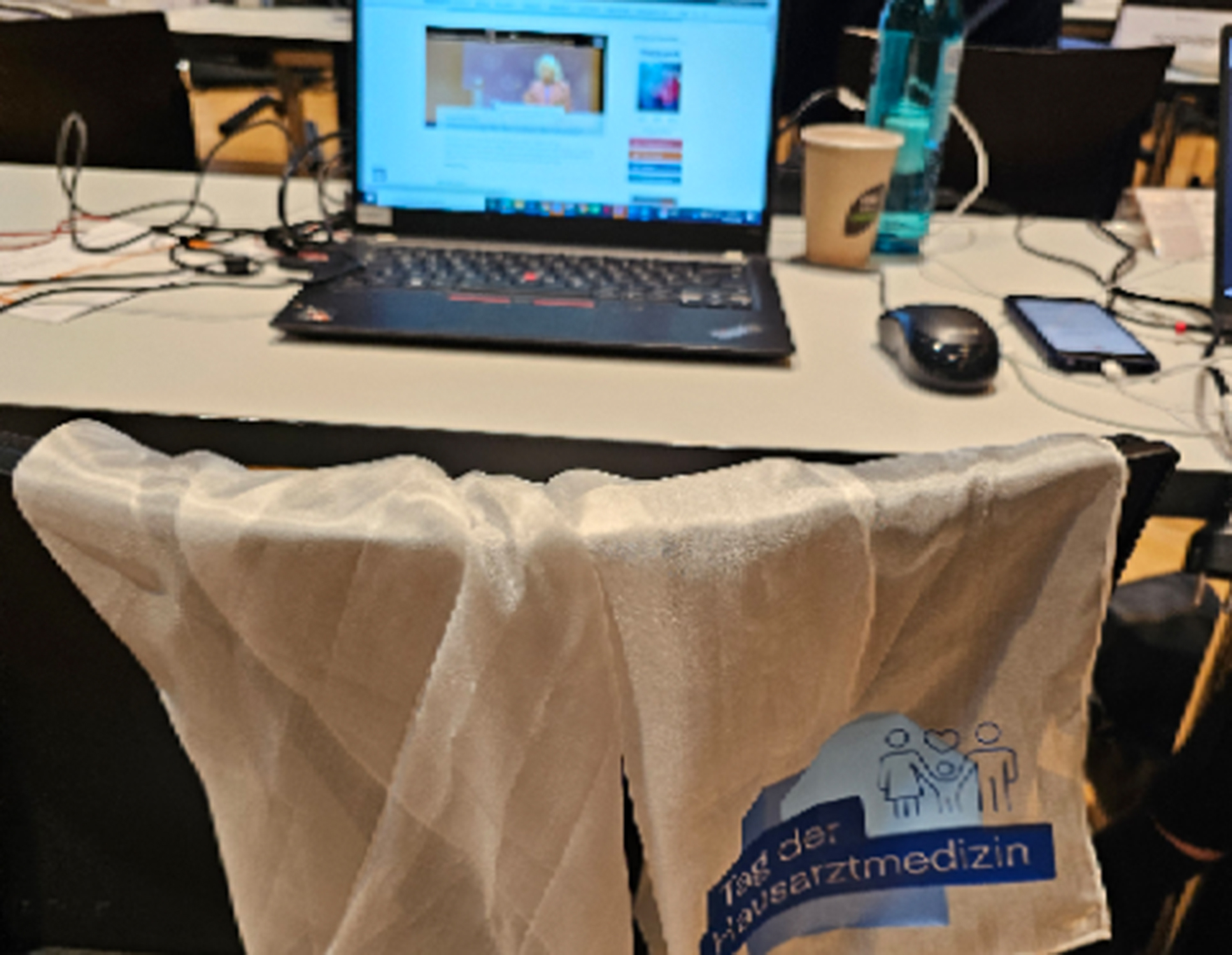In seiner Zeit als Direktor des Zentrums für Kardiologie der Universitätsmedizin Mainz hat sich Prof. Dr. Thomas Münzel 15 Jahre lang mit Umweltforschung beschäftigt. “Inzwischen ist es eigentlich schon nicht mehr fünf Minuten vor, sondern eher fünf Minuten nach zwölf”, erklärte er in seinem Vortrag anlässlich der Reihe “Visions for Climate” der Universität Mainz.
Lange musste er darum kämpfen, dass dieses Thema ernst genommen wird. Beim Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie besuchen zum Beispiel 500 Kolleginnen und Kollegen das Hochdruck-, 400 das Cholesterin- und 20 das Umweltkardiologieseminar, so seine Erfahrung. Erst in den letzten Jahren habe das Interesse an Umweltthemen deutlich zugenommen.
Viele Todesfälle umweltbedingt
Extreme Klimaereignisse verdeutlichen das Problem – etwa eine Hitzewelle mit bis zu 53 Grad Celsius und wenige Monate später katastrophale Überschwemmungen in Pakistan oder Kälteeinbrüche in den USA mit minus 78 Grad Celsius. Münzel wies darauf hin, dass es jährlich zu 5 Millionen temperaturbedingter Todesfälle kommt; an den Folgen der Luftverschmutzung starben 2021 weltweit 8,1 Millionen Menschen.
Wir geben viel Geld für die Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen aus. Aber an der Prävention hapert es, bemängelte er. Von 1990 bis 2019 ereigneten sich weltweit 20,5 Millionen Todesfälle auf dem Boden von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, von diesen waren 20 Prozent durch die Umwelt bedingt.
Im Einzelnen sind dabei Luft- und Lichtverschmutzung, hohe Temperaturen durch Klimaveränderungen, Verkehrslärm und schlechte Stadtplanung zu nennen.
Drill, baby, drill!?
Was die Luftverschmutzung angeht, sind die Top-Drei-CO2-Emittenten China, Indien und die USA, die zusammen für über 50 Prozent der Luftverschmutzung verantwortlich sind. Gegenmaßnahmen sind derzeit kaum zu erwarten. Die letzte Klimakonferenz COP29 im November sei eine absolute Katastrophe gewesen.
So meinte zum Beispiel Sultan Ahmed Al Jaber von den Vereinigten Arabischen Emiraten, es gäbe keinen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass ein Ausstieg aus fossilen Brennstoffen die Erderwärmung vermindern könne. Damit würde man ins Zeitalter der Höhlenmenschen zurückfallen.
Der Präsident des Gastgeberlands Aserbaidschan, Ilham Alijew, bezeichnete fossile Brennstoffe als ein Geschenk Gottes. Ganz zu schweigen von der bekannten Haltung Donald Trumps zu diesem Thema. Den republikanischen Slogan “Drill, baby, drill” zur verstärkten Öl- und Gasförderung hat er begeistert übernommen.
Hitze-Tote holen auf
Weltweit versterben circa 5 Millionen Menschen jährlich an den Folgen extremer Temperaturen, was etwa zehn Prozent aller Todesfälle entspricht. Dabei sind neun von zehn Fällen extremer Kälte und einer von zehn extremer Hitze geschuldet. Die Wahrscheinlichkeit ist aber sehr groß, dass sich dieses Verhältnis zugunsten der Hitzetoten verändern wird, so Münzel.
Die globale Durchschnittstemperatur steigt um 0,2 Grad Celsius pro Jahr. Die Jahre nach 2020 sind die heißesten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Und ein Anstieg der Referenztemperatur um 1 Grad Celsius geht mit einem Anstieg der Sterblichkeit an Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 2,1 Prozent und der kardiovaskulären Morbidität um 0,5 Prozent einher, verdeutlichte der Referent.
Während Hitzewellen kann das Risiko einer hitzebedingten Sterblichkeit um mehr als 10 Prozent steigen. Die WHO prognostiziert, dass es zwischen 2030 und 2050 jährlich zu rund 250.000 Todesfällen aufgrund von Hitzeeinwirkung kommen wird.
Sowohl extreme Hitze als auch extreme Kälte münden auf verschiedenen Wegen letztlich in dieselben Auswirkungen – ischämische Herzerkrankung und Schlaganfall. Vulnerable Risikogruppen sind vor allem ältere Menschen, Kinder, Schwangere, Personen, die im Freien arbeiten, und Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen oder Medikamenteneinnahme. Patienten mit Herzinsuffizienz reagieren dabei auf Hitze empfindlicher als auf Kälte.
Begrünung kann Leben retten
Über vier Prozent der Sommersterblichkeit in Städten ist den negativen Wirkungen von Hitzeinseln, also versiegelten Flächen, zuzuordnen. Ziel sollte sein, über 30 Prozent der Stadtflächen zu begrünen. Damit könnte man die Temperatur um bis zu 1,3 Grad Celsius reduzieren und so ein Drittel dieser Todesfälle verhindern.
Durch grüne Infrastruktur lassen sich auch die negativen Effekte von Lärm und Luftverschmutzung reduzieren, die körperliche Aktivität fördern und die psychische Gesundheit stärken. Zwei Drittel der europäischen Bevölkerung lebt in städtischen Gebieten, Tendenz steigend.
Positive Beispiele für eine gute Städteplanung sind Barcelona mit autofreien Superblocks im Zentrum und Seoul und Düsseldorf mit dem Ersatz einer Autobahn mitten in der Stadt durch einen Kanal bzw. Grünflächen.
Tod durch Feinstaub
Luftverschmutzung besteht zum einen aus Gasen wie CO2, NO2 und Ozon, zum anderen aus Feinstaub unterschiedlicher Partikelgröße. Feinstaub gelangt zunächst in die Lunge und von dort in die Blutgefäße, wo Entzündungsprozesse angestoßen werden können – die Vorstufe einer Gefäßverkalkung. Bei 0,1 µm spricht man von Ultrafeinstaub. Dieser Durchmesser entspricht etwa dem eines Virus.
Ultrafeinstaub gelangt direkt ins Gehirn und kann eine Blutdrucksteigerung bewirken. Möglicherweise können auch Krankheitserreger an Feinstaubpartikel binden. Dies würde die Übersterblichkeit an Covid-19 in Gebieten hoher Feinstaubbelastung erklären.
Hitze verstärkt die Luftverschmutzungseffekte. In einer großen Studie in 150 europäischen Städten hat man belegen können, dass bei konstanter Temperatur eine höhere Feinstaubkonzentration die Sterblichkeit dramatisch ansteigen lässt. Hochgerechnet auf die ganze Welt verkürzt der Feinstaub unser Leben um durchschnittlich 2,9 Jahre, machte Münzel klar.
Unter den Risikofaktoren für einen frühen Tod steht mittlerweile der Feinstaub nach hohem Blutdruck und vor Tabakkonsum an zweiter Stelle. In einer chinesischen Studie konnte zudem nachgewiesen werden, dass auch kurzzeitige Peaks erhöhter Feinstaubkonzentrationen bei Patienten mit vorgeschädigten Koronarien akute Herzinfarkte auslösen können.
Weit entfernt von WHO-Limits
Was kann die Politik tun? Die von der WHO geforderten Limits zum Feinstaub liegen bei 5 µg/m3. Allerdings sind 99 Prozent der Weltbevölkerung höheren Konzentrationen ausgesetzt. In Europa liegt das Limit bei 25 µg/m3. Bis 2030 will man auf 10 µg/m3 kommen.
Hierbei handelt es sich um eine EU-Direktive, die bei Nichteinhalten sogar eingeklagt werden kann, betonte Münzel. Die Umwelthilfe könnte dann den Verkehr in Großstädten lahmlegen. Würde man auf fossile Brennstoffe verzichten, könnte man nach einer Studie von Prof. Jos Lelieveld vom Mainzer Max-Planck-Institut jährlich weltweit fünf Millionen Leben retten.
Und wie könnte sich jeder Einzelne vor Luftverschmutzung schützen? Atemmasken, Luftfilter und das Meiden verschmutzter Umgebungen sowie Sport (aber nicht bei hoher Feinstaubbelastung) wären mögliche Optionen.
Auch Lärm macht krank
Lärm ist laut WHO der zweitwichtigste krankmachende Umweltstressor. Hier besteht das Ziel darin, beim Verkehrslärm unter 55 Dezibel zu bleiben. Damit könnte man pro Jahr 110.000 Leben retten, so Münzel.
Literatur: