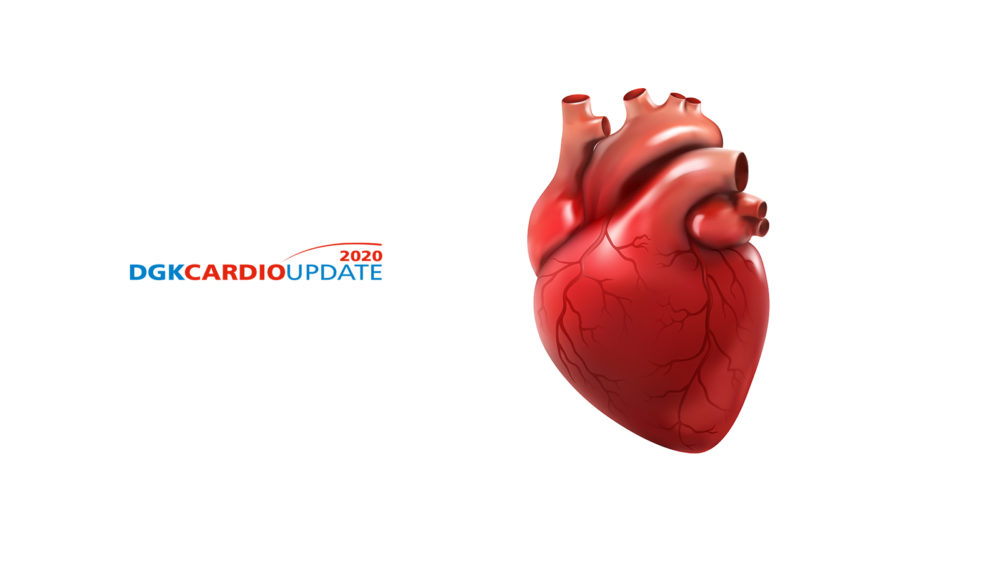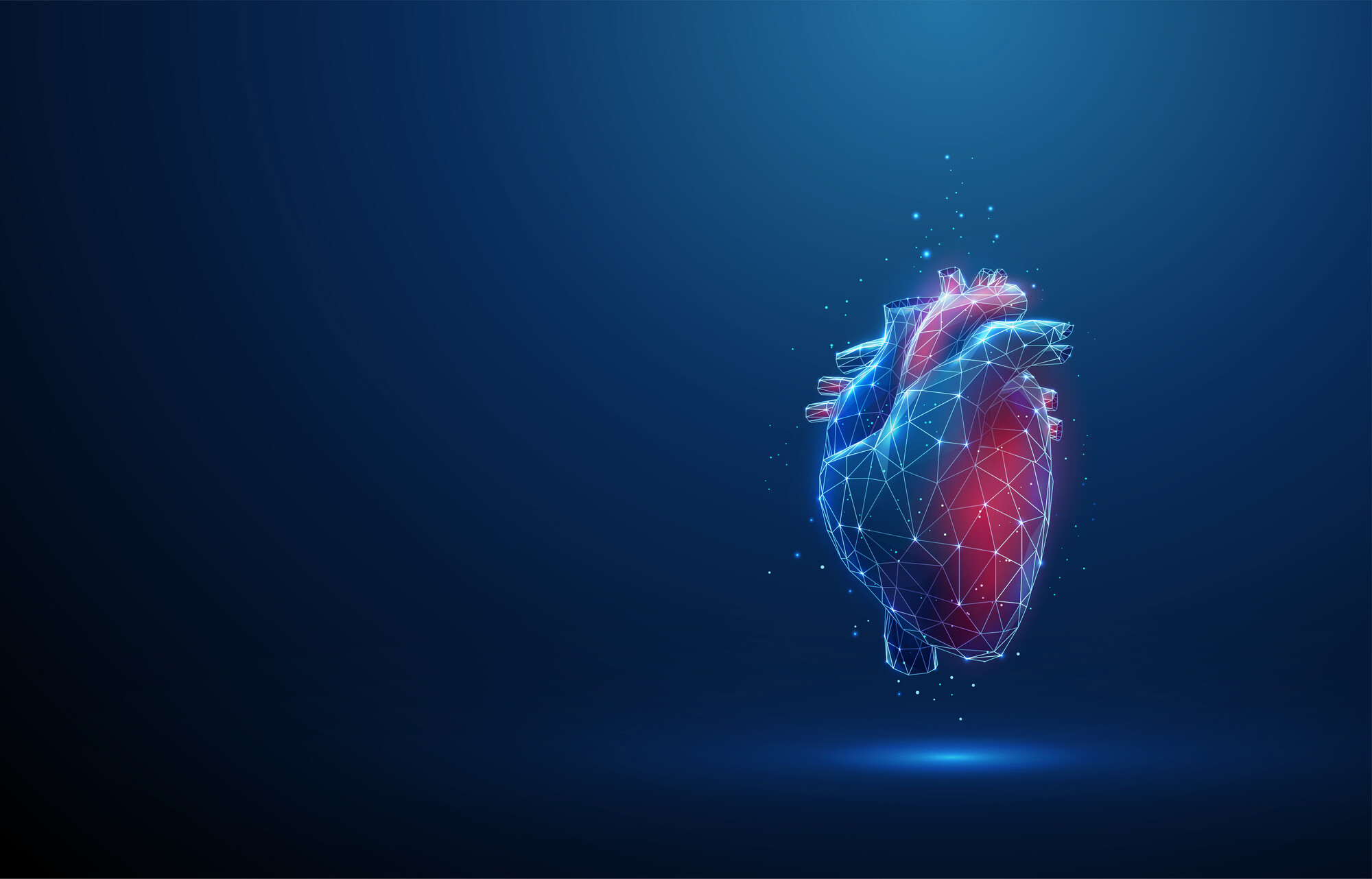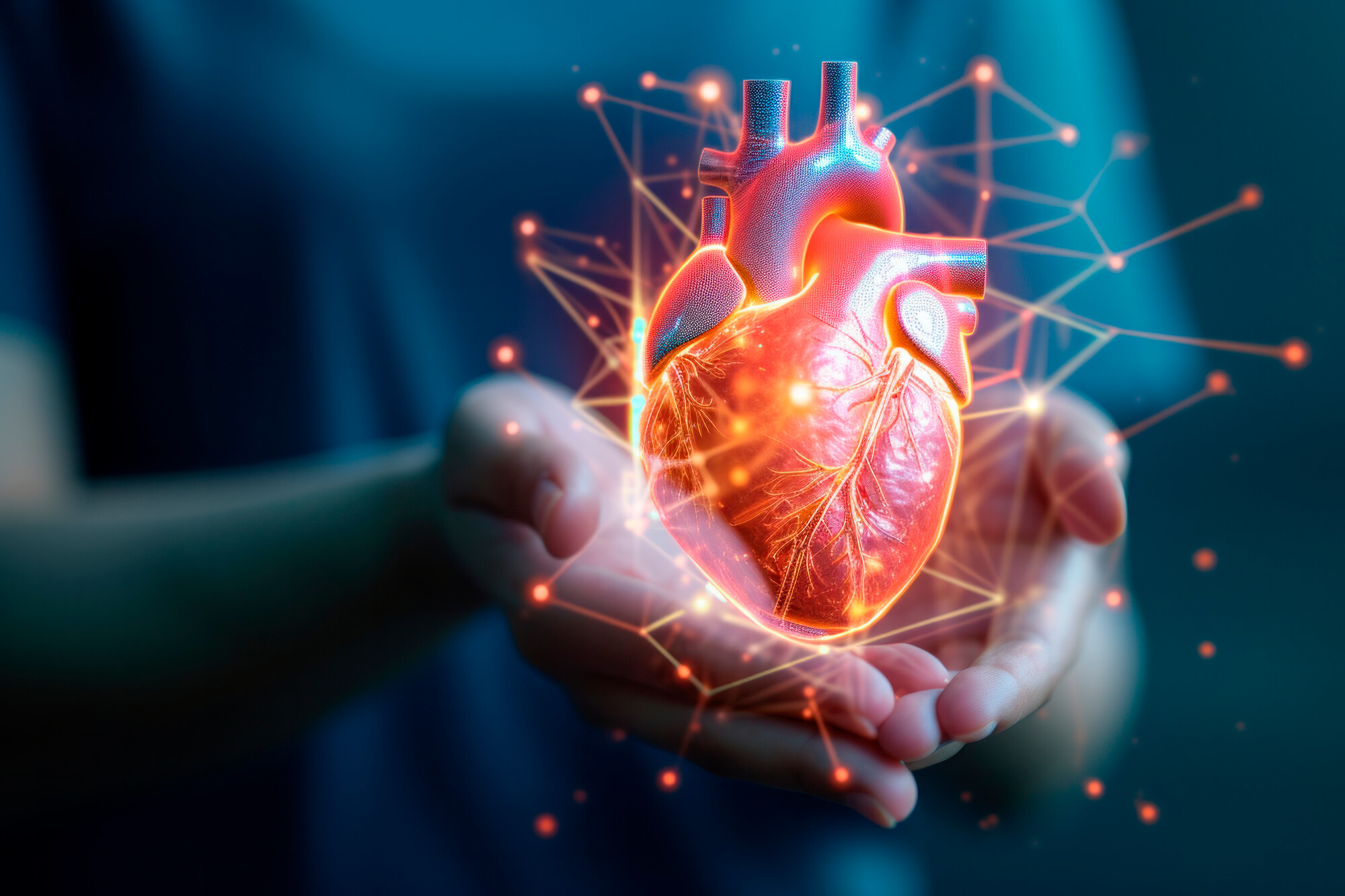Hypertonie
Dass sowohl der systolische als auch der diastolische Blutdruck mit einem erhöhten kardiovaskulären Risiko assoziiert sind, ist unbestritten. Ob allerdings der systolische oder diastolische Wert wichtiger für die Prognose ist, darüber bestand bisher Unklarheit. Dieser Frage ist man jetzt in einer Studie nachgegangen, wobei 36 Millionen Blutdruckmessungen von 1,3 Millionen Menschen aus einer Versicherungsdatenbank analysiert wurden.
In der Studie bestätigte sich, dass sowohl ein erhöhter systolischer als auch ein erhöhter diastolischer Blutdruckwert das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall erhöhen. Doch der systolische Wert hatte einen stärkeren prognostischen Effekt. Und der diastolische Wert beeinflusste die Prognose unabhängig vom systolischen Wert.
Doch der Bluthochdruck erhöht nicht nur das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und Niereninsuffizienz sondern steht auch in enger Beziehung zu Klappenfehlern insbesondere Aortenstenose und Aorteninsuffizienz. Pro Anstieg des systolischen Blutdrucks um 20 mm Hg steigt das relative Risiko für eine Aortenstenose um 41 Prozent und für eine Aortenklappeninsuffizienz um 38 Prozent.
Die gültigen Leitlinien zur Behandlung der arteriellen Hypertonie empfehlen zur Diagnosesicherung zusätzlich zu Praxismessungen auch praxisunabhängige Messungen entweder mittels 24-Stunden-Langzeitblutdruckmessung oder durch häusliche Blutdruckmessungen. In einer Studie wurde die Assoziation zwischen den verschiedenen Blutdruckmessmethoden – automatisierte Blutdruckmessungen in der Praxis, ambulant über 24 Stunden, bei Tag und bei Nacht – mit den Mortalitätsraten und kardiovaskulären Ereignissen (kardiovaskuläre Mortalität, nicht-tödliche kardiovaskuläre Ereignisse, Herzinsuffizienz und Schlaganfall) untersucht.
Alle Endpunkte waren am stärksten mit den Blutdruckwerten in der Nacht bzw. während 24 Stunden assoziiert. Für jeden Anstieg des nachts gemessenen Blutdrucks um 20/10 mm Hg stieg das Mortalitätsrisiko um 23 Prozent und das Risiko für ein kardiovaskuläres Ereignis um 36 Prozent (Felix Mahfoud, Homburg).
Antihypertensiva
Für die Erstbehandlung der arteriellen Hypertonie bei Patienten ohne wesentliche Begleiterkrankungen empfiehlt die Leitlinie ACE-Hemmer/AT1-Blocker, Kalziumkanalblocker oder Diuretika. Ein Vergleich der verschiedenen Substanzgruppen im Hinblick auf ihren protektiven Effekt ergab: Patienten, bei denen die Therapie mit einem Thiazid-Diuretikum begonnen wurde, schnitten am besten ab.
Die relative Risikoreduktion bei Gabe eines Diuretikums im Vergleich zu einem ACE-Hemmer betrug für Schlaganfall 17 Prozent, für Herzinsuffizienz-Hospitalisation 17 Prozent und 16 Prozent für den akuten Myokardinfarkt.
Daten aus Verschreibungsregistern ergaben einen kumulativen dosisabhängigen Zusammenhang zwischen HCT und nicht-melanozytärem Hautkrebs, wobei das Risiko für ein Basalzellkarzinom um das 1,3-fache und für das Plattenepithelkarzinom um das 4- bis 7,7-fache erhöht ist. Wie bei jeder Kohortenstudie kann damit nur eine Assoziation aber keine Kausalität bewiesen werden.
Die Deutsche Arzneimittelkommission empfiehlt daher keine generelle Therapieumstellung aller mit HCT-behandelten Patienten, sondern eine individuelle Prüfung und regelmäßige Hautinspektionen. Mögliche Alternativen sind Chlorthalidon und Indapamid, allerdings liegen bei diesen Präparaten keine Daten zum Hautkrebsrisiko vor (Felix Mahfoud, Homburg).
Niereninsuffizienz
Die chronische Niereninsuffizienz ist einer der wichtigsten Risikofaktoren für die Entstehung einer Atherosklerose und eine der häufigsten Komorbiditäten der KHK. Bei Patienten mit Niereninsuffizienz ist sowohl das Risiko für thromboembolische Ereignisse als auch für Blutungskomplikationen erhöht im Vergleich zu Nierengesunden.
Die neuen Leitlinien zum chronischen Koronarsyndrom empfehlen bei Risiko-Patienten mit einem nicht oder nur moderat erhöhten Blutungsrisiko eine verlängerte antithrombotische Kombinationstherapie zur Verbesserung der Prognose. Hierzu steht sowohl eine verlängerte duale Plättchenhemmung als auch die Kombination ASS plus niedrig-dosierten Rivaroxaban zur Verfügung. Geeignet für dieses Therapiekonzept sind Patienten mit einer Mehrgefäßerkrankung, Diabetes mellitus, Zustand nach Re-Infarkt, PAVK, Herzinsuffizienz und/oder chronischer Niereninsuffizienz.
In der COMPASS-Studie führte die Kombination ASS plus Rivaroxaban zu einer Abnahme von kardiovaskulär-bedingtem Tod, Herzinfarkt und Schlaganfall. Die Blutungskomplikationen waren unter der dualen antithrombotischen Therapie im Vergleich zu ASS erhöht, aber nicht unterschiedlich zwischen Patienten mit und ohne Niereninsuffizienz (Felix Mahfoud, Homburg).